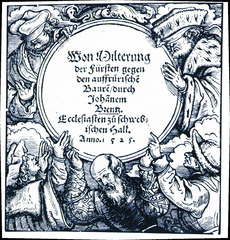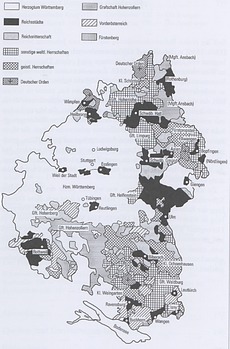Der deutsche Südwesten um 1500: Politik – Gesellschaft – Kirche und Frömmigkeit
-
Inhaltsverzeichnis
- 1: Zentrale Strukturelemente der politischen Ordnung
- 1.1: Das Reich: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation
- 1.2: Wer regiert das Reich?
- 1.3: Welche Institutionen trugen das Reich?
- 1.4: Strukturelle Defizite und Herausforderungen
- 2: Zentrale Strukturelemente der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung - Humanismus
- 2.1: Gesellschaft
- 2.2: Wirtschaft
- 2.3: Stadt, Humanismus und beginnende Medienrevolution
- 3: Kirche, Frömmigkeit und Theologie
- 3.1: Die Kirche
- 3.2: Spätmittelalterliche Frömmigkeit: Forschung, Gottesdienst und Kirchenbau
- 3.3: Veräußerlichung von Frömmigkeit: Stiftungswesen, Heiligenvereehrung ...
- 3.4: Verinnerlichung von Frömmigkeit: Devotia moderna, Prädikaturen ...
- 3.5: Die akademische Theologie des 15. Jahrhunderts
- 3.6: Krise der Kirche am Ausgang des Mittelalters?
- Anhang
1: Zentrale Strukturelemente der politischen Ordnung
1.1: Das Reich: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation
Seit dem späten 15. Jahrhundert wird das vom deutschen Kaiser und römischen König regierte Reich als „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ tituliert.
Heiligkeit wurde diesem Reich deswegen zugeschrieben, weil es in einer geschichtstheologischen Perspektive gedeutet wurde. Die Zeitgenossen verstanden das Reich dank der Theorie der Translatio Imperii, der Übertragung imperialer Gewalt, als Fortsetzung des römischen Reiches. Dieses seinerseits galt als letztes der Vier Reiche, die der Prophet Daniel in seinem Traum geschaut hatte (Dan. 2 und 7) und bei dessen Untergang die Wiederkehr des Erlösers verheißen war. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation wahrte somit als gedachte Ordnung die Kontinuität mit dem römischen Reich, jenseits aller Brüche, die seit dem realpolitischen Untergang des römischen Kaisertums im 5. Jahrhundert zu verzeichnen waren.
Beides, die Sakralität des Reiches und die damit unlösbar verknüpfte Fortführung des römischen Reiches, begründete die Superiorität dieses Reiches über alle anderen Mächte der lateinischen Christenheit (nicht über die griechisch-orthodoxe Christenheit, an deren Spitze bis zur Eroberung Konstantinopels – des heutigen Istanbuls – durch die Türken im Jahre 1453 der byzantinische Kaiser gestanden hatte). Allerdings kam dieser Superioritätsanspruch im ausgehenden Mittelalter mit der politischen Wirklichkeit Westeuropas definitiv nicht mehr überein. Dem trug die Formel deutscher Nation Rechnung: Dieser Zusatz war Verengung und Vereindeutigung zugleich. Er trug, unbeschadet des weiterhin aufrecht erhaltenen universalen Geltungsanspruch des Kaisers, dem Umstand Rechnung, dass dieses Reich im deutschen Reich verankert war, mithin Teil eines größeren Ganzen.
1.2: Wer regiert das Reich?
-
Karl V Kaiserkrönung in Bologna. Gemälde von Juan de la Corte, 1660, Museo de Santa Cruz, Toledo
Deutscher König und römischer Kaiser
Dieses römische Reich deutscher Nation wurde von einem gewählten deutschen König regiert, der nach seiner Krönung durch den Papst zugleich den Titel eines römischen Kaisers trug. Die letzte Kaiserkrönung in dieser Form fand 1530 in Bologna statt, als Karl V. aus dem Hause Österreich am 24. Februar die Kaiserkrone aus der Hand des Papstes empfing.
Der nunmehrige Kaiser aus der damals bedeutendsten Dynastie des westlichen Abendlandes, der Habsburger, war der mächtigste Herrscher der damaligen Christenheit. Seine Herrschaftstitulatur lautet wie folgt: Wir, Karl der Fünfte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, in Germanien, zu Kastilien, Aragon, León, beider Sizilien, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galizien, Mallorca, Sevilla, Sardinien, Córdoba, Korsika, Murcia, Jaén, Algerien, Algeciras, Gibraltar, der Kanarischen und Indianischen Inseln und des Festlandes, des Ozeanischen Meers &c. König, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten, zu Krain, zu Limburg, zu Luxemburg, zu Geldern, zu Kalabrien, zu Athen, zu Neopatria und zu Württemberg &c. Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, zu Görz, zu Barcelona, zu Artois und zu Burgund &c. Pfalzgraf zu Hennegau, zu Holland, zu Seeland, zu Pfirt, zu Kyburg, zu Namur, zu Roussillon, zu Cerdagne und zu Zutphen &c. Landgraf im Elsass, Markgraf zu Burgau, zu Oristan, zu Goziani und des Heiligen Römischen Reiches, Fürst zu Schwaben, zu Katalonien, zu Asturien &c. Herr zu Friesland und der Windischen Mark, zu Pordenone, zu Biscaya, zu Monia, zu Salins, zu Tripolis und zu Mecheln &c – ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging, zugleich aber ein Reich, das ob seiner gewaltigen Dimensionen kaum zu regieren war. Die Teilung dieses Reiches bereits vor der Abdankung Karls V. im Jahre 1558 zwischen seinem Sohn Philipp und seinem Bruder Ferdinand, welche die spanisch-niederländischen bzw. deutschen Besitzungen des Hauses zugesprochen bekamen, wie auch die mehrfachen Teilungen der deutschen Linie des Hauses seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren zwar vorrangig dynastischem Denken geschuldet. Sie trugen aber auch dem Umstand Rechnung, wie unter den Bedingungen der frühen Neuzeit die Herrschaft über nun deutlich verkleinerte Räume bestmöglich gewährleistet werden könne.
Trotz all seiner Machtfülle war der Kaiser kein absoluter Herrscher, dessen alleiniger Wille zählte. An der Herrschaft waren stets auch andere beteiligt. Im Heilige Römische Reich deutscher Nation waren dies vor allem die Kurfürsten, Fürsten und, wenngleich weniger bedeutsam, ein Teil der Städte, die sog. Reichsstädte.
Kurfürsten
Die sieben Kurfürsten unterteilten sich in zwei Gruppen: Geistliche Kurfürsten – und zugleich geistliche Würdenträger – waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier; der Kurpfalz, Kursachsen und Kurbrandenburg entstammten die weltlichen Kurfürsten, demzufolge auch Luthers Landesherren, Friedrich d. Weise, Johann und Johann Friedrich I. Die siebte, die bömische Kur, ruhte seit 1526, weil die Habsburger als römische Könige zugleich die Landesherren von Böhmen waren.
Die Kurfürsten waren zwar gleichen Ranges, aber unterschiedlicher Machtfülle. Gemeinsam war ihnen der Bezug zum Reich, so dass – wenngleich übertreibend – gesagt werden kann, dass Kaiser und Kurfürsten im Gegen- und Miteinander bis ins frühe 17. Jahrhundert hinein maßgeblichen Anteil am politischen Geschick des Reiches hatten. Die Rede von den Kurfürsten als „Säulen des Reiches“ trug dem sprachlich Rechnung.
-
Mächtespiel 1515: Die Mächtigen des Reiches pokern um Mailand. Unter den Zuschauern findet sich unter (H) Herzog Ulrich von Württemberg. Unbekannter Meister, um 1515.
Fürsten
Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind um 1375/1400 ungefähr achtzig „reichsfürstliche Kräfte“ (Moraw) anzunehmen, wobei die geistlichen Fürsten weltliche Macht (und demzufolge einen weltlichen Herrschaftsbereich) und geistliches Amt (und demzufolge einen kirchlichen Zuständigkeitsbereich, die Diözese) in einer Hand vereinigten. Zahlenmäßig übertrafen sie ihre weltlichen Standesgenossen bei weitem. Ebenso deutlich waren sie ihnen an realer Macht unterlegen.
Der politische Handlungsraum „des“ spätmittelalterlichen Fürsten war vorrangig ist die eigene Landesherrschaft. Ihr galten die mehr oder minder stringent verfolgten Bestrebungen, mit unterschiedlichen Rechts-, Gesellschafts- und Gewaltformen die zumal dem Hochadel vorgegebene Befähigung zur Herrschaft zu steigern und zu verstetigen. Als idealtypisches Endziel erfolgreicher Landesherrschaft kann nach innen „die Angleichung der Einwohner in Gestalt eines Untertanenverbandes und das Streben nach einem Gewaltmonopol gegenüber diesem Verband“ (1) aufgefasst werden, Zielsetzungen mithin, die gemeinhin erst spät in der Neuzeit erreicht wurden. Nach außen, im Gegenüber der Nachbarn, manifestiert sich erfolgreich-aggressive Landesherrschaft im Streben nach regionaler Hegemonie.
Die raison d´ etre fürstlicher Herrschaft im spätmittelalterlichen Reich mündete daher in einen Ausleseprozess, der Mächtige und minder Mächtige schied und die politische Landkarte des spätmittelalterlichen Reichs drastisch vereinfachte: Im Vollsinn des Wortes handlungsfähig waren nur sehr wenige Fürsten, die sukzessive in die Rolle regionaler „Systemführer“ (Moraw) hineinwuchsen. Die große Mehrzahl – zumal der geistlichen Fürsten – befand sich in einem mehr oder minder verfestigten Abhängigkeitsverhältnis von diesen wirklich Großen. Deren Bezug zum Reich war, gleichsam als Kontrapunkt ihrer Konzentration auf die Verdichtung ihrer Herrschaft im Nahraum und ihres Denkens in (potentiell raumübergreifenden) dynastischen Kategorien, erheblich reduziert. Für die Kohärenz des spätmittelalterlichen Reichsverbandes „leisteten“ die Fürsten infolgedessen bis weit in das 15. Jahrhundert hinein wenig, im Unterschied zu den Kurfürsten. Und erst im Verlauf des frühen 17. Jahrhunderts sollte es den Fürsten gelingen, die Vormacht der Kurfürsten definitiv zu brechen.
Die Grafen und Herzöge von Württemberg
Zu diesen Fürsten zählten auch die Grafen bzw. (seit 1495) die Herzöge von Württemberg. Sie zählten zu den „Aufsteigern“ des 15. Jahrhunderts und geboten nach mehrfachen innerdynastischen Konflikten und Verwerfungen um 1500 über ein einigermaßen konsolidiertes und befriedetes Land. Wie der Kaiser über das Reich, so waren auch die Grafen und Herzöge von Württemberg in ihrer Herrschaft auf den Konsens der Mächtigen des Landes verwiesen, die in sog. Landständen organisiert waren. Spezifisch für Württemberg war, dass sich der regionale Adel den Herrschern aus dem Hause Württemberg weitgehend entziehen konnte. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts bildete er einen Teil der Reichsritterschaft, für die der direkte Bezug zum Oberhaupt des Reiches konstitutiv war. Die Stände des Landes setzten sich daher aus zwei Gruppierungen zusammen: den Prälaten, d.h. den Vorständen der großen Klöster im Lande; und den Amtsstädten, an deren Spitze die zunehmend aus der bürgerlichen Machtelite des Landes, die sogenannten Ehrbarkeit, stammenden Obervögte standen.
1503 wurde der damals elf Jahre alte Herzog Ulrich von Kaiser Maximilian vorzeitig für mündig erklärt. Er übernahm nun diie Regierungsgeschäfte in Württemberg. 1504/05 gehörte er als Parteigänger des Kaisers zu den großen Gewinnern des Landshuter Erbfolgekrieges, der seine Lande erheblich vergrößern sollte, und 1511 feierte er seine vom Kaiser vermittelte Hochzeit mit Sabine von Bayern, eine Eheschließung, die den Aufstieg des Hauses zu krönen schien – der Grafensohn heiratete die Kaiserenkelin. Die Jahre 1513/14 führten Ulrich dann aber die Schwäche seiner Herrschaft plastisch vor Augen: Den Aufstand des Armen Konrads, hervorgerufen durch die finanziellen Belastungen des gemeinen Mannes, konnte er nur mit Hilfe der Ehrbarkeit und kaiserlich-fürstlicher Vermittlung beilegen. Der Tübinger Vertrag vom Juli 1514 war daher eine Niederlage des Herzogs, weil dieses Rechtsdokument die ohne starke Stellung der Landstände weiter befestigte. Für die Politik Herzog Ulrichs hatte die Herrschaftskrise weitreichende Folgen: Jetzt verfolgte er seine Bemühungen, die Position von Land und Haus Württemberg zu konsolidieren und zu befestigen, mit anderen Mitteln und einer Stoßrichtung, die sich gegen die Ehrbarkeit, den Adel sowie die Reichsstädte richtete. Mit den benachbarten Wittelsbachern überwarf er sich ob seiner unglücklichen Ehe, mit Kaiser Maximilian wegen der übermächtigen Position der Habsburger im Südwesten des Alten Reiches. Als er den Tod des Habsburgers 1519 nutzte, um die Reichsstadt Reutlingen württembergischer Botmäßigkeit zu unterwerfen, hatte er den Bogen überspannt. Benachbarte Fürsten und Städte, im Schwäbischen Bund zusammengeschlossen, unterwarfen das Land und nötigten seinen Herrscher zur Flucht. 1520 wurde Württemberg an die Habsburger verkauft, um vom jüngeren Bruder Kaiser Karls V., Erzherzog/ König Ferdinand, bis 1534 regiert zu werden. Ulrich selbst lebte im Exil – anfangs bei seinem Halbbruder Georg, dem die Herrschaft über Mömpelgard übertragen worden war, seit 1526 am Hof Landgraf Philipps von Hessen. Der neuen Lehre hatte er sich bereits zuvor zugewandt.
1.3: Welche Institutionen trugen das Reich?
Als die entscheidende Kommunikations- und Handlungsplattform, um über die Geschicke des Reiches zu beraten und zu befinden, hatte sich nach langem Ringen am Ende des Mittelalters der Reichstag etabliert. Er wurde vom König/ Kaiser einberufen, der ihm auch die zu behandelnden Beratungsgegenstände (die sog. Proposition) vorlegte. Diese wurde in den sog. Kurien der Kurfürsten, Fürsten und Städte getrennt beraten und erst nach erfolgter Verständigung zwischen den Kurien dem Reichsoberhaupt kommuniziert; in den daran anschließenden, oft langwierigen Verhandlungen zwischen Reichsoberhaupt und Ständen erfolgte dann die definitive Beschlussfassung. Diese wurde in Form der 1497 eingeführten Reichsabschiede vom Reichsoberhaupt, dessen Zustimmung zwingend erforderlich war, verkündet.
Zwar existierten jenseits des Reichstages weitere Einrichtungen des Reiches, vorläufig aber nur in rudimentärer und wenig effektiver Form. Dies gilt insbesondere für das Reichskammergericht, dem in Konkurrenz zur Reichshofrat die höchste Rechtssprechung im alten Reich oblag; ebenso gilt es für die Reichskreise, Exekutivorgane zur Durchsetzung des Friedens im Reich und der Beschlüsse des Reichskammergerichts. Faktisch kam ihnen allerdings erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vermehrt realpolitische Bedeutung zu.
1.4: Strukturelle Defizite und Herausforderungen
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation sah sich um 1500 mit mehreren „Herausforderungen“ konfrontiert. Die wichtigsten waren:
-
Die Bedrohung von außen: An nahezu allen Grenzen des Reiches wurden militärische Auseinandersetzungen mit mehr oder minder großer Intensität ausgetragen – mit den Türken, deren Vorwärtsdrang auch nach der Eroberung Konstantinopels 1453 andauerte, sowie mit dynastischen Konkurrenten und politischen Rivalen (vornehmlich in Italien, im Grenzraum zu Frankreich und im böhmisch-ungarischen Bereich);
-
die finanzielle Schwäche des Reiches sowie das Fehlen eines stehenden Heeres;
-
die Abhängigkeit des Kaisers auf Konsensfindung mit den wirklich Mächtigen dieses Reiches, wobei die Interessen vielfach weit auseinanderlagen und (auch) deswegen oft mit kriegerischen Mitteln ausgetragen wurden.
2: Zentrale Strukturelemente der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung - Humanismus
2.1: Gesellschaft
Die Gesellschaft der frühen Neuzeit wird als ständische Gesellschaft bezeichnet.Dieser wissenschaftliche Ordnungsbegriff rekurriert seinerseits auf das Selbstverständnis der Zeit. Die so „konstruierte“ ständische Gesellschaft wurde gedacht:
-
als Spiegelbild der von Gott geschaffenen Schöpfungsordnung, die ein für allemal feststeht, und daher statisch;
-
als eine auf sozialer Ungleichheit beruhende Ordnung, die durch Geburt zustande kommt und in zahllosen Privilegien bestätigt wird. Die Gesellschaft war daher strikt hierarchisch, aber nicht aufgrund ökonomischer Unterschiede, sondern als Ausfluss rechtlicher, sozialer und kultureller Gegebenheiten;
-
als sinnstiftendes und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleistendes Regulativ fungierte der Gedanke, dass ein jeder an seinem Platz spezifische Funktionen zu erfüllen habe und dass die drei so geschiedenen Stände – der Lehrstand (Klerus), der Wehrstand (Adel) und der Nährstand (die städtische und ländliche Bevölkerung) – zum Wohle des Ganzen auf einander verwiesen seien.
-
Das Bild der Gesellschaft war infolgedessen vom Ideal der Harmonie geprägt. Konflikte, - gängig in der Realität, wurden infolgedessen nicht als integrale Bestandteile gesellschaftlichen Zusammenlebens verstanden, sondern wurden als störende und möglichst rasch zu beseitigende Normabweichungen gedeutet. Spätfolgen dieses Denkansatzes reichen bis in das 20. Jahrhundert, z.B. wenn in der Weimarer Republik die für eine parlamentarischen Demokratie konstitutive Form der politische Meinungsbildung als „Parteiengezänk“ diskreditiert wurde.
2.2: Wirtschaft
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein dominant agrarisches Land. Dabei gilt es in Erinnerung zu behalten, dass Stadt und Land keine völlig getrennten Lebenswelten darstellten – im Gegenteil. So sehr sich die Tätigkeitsmerkmale von Bauern und städtischen Bürgern auch unterscheiden konnten, so dicht gehörten Stadt und Land um 1500 zusammen. Keine Stadt war so groß, dass sie dem Land völlig fern gerückt wäre, viele aber waren so klein, dass sie von den Dörfern nicht zu unterscheiden waren. Die meisten waren sog. Ackerbürgerstädte, d.h. ein großer Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig. Und selbst große Kommunen wie Straßburg, wo der Handel eine bedeutende Rolle spielte, wies einen hohen Anteil von Gärtnern auf, also Menschen, die einer agrarischen Tätigkeit nachgingen. Die Zahl der großen Städte im Reich war im Übrigen überschaubar: zu denken wäre in erster Linie an Köln, Augsburg oder Nürnberg.
2.3: Stadt, Humanismus und beginnende Medienrevolution
Vor allem die großen Städte waren auch der Nähr- und Wurzelboden einer der bedeutensten geistesgeschichtlichen Strömungen des späten Mittelalters, des Humanismus. So bedeutend der ursprünglich in Italien beheimatete Humanismus ohne jede Frage war und so sehr er zu den elementaren Voraussetzungen der Reformation zu rechnen ist, so nachdrücklich gilt es darauf aufmerksam zu machen, dass der Humanismus ein Elitenphänomen darstellt. Sozial war er ihm Bürgertum großer Städte verortet, aber auch im gebildeten Klerus stieß er auf einen durchaus fruchtbaren Resonanzboden. Zu seinen wichtigsten Leistungen zählt:
-
Der Humanismus griff – auch nördlich der Alpen – die geistigen Impulse der italienischen Renaissance auf. Dazu gehörte insbesondere eine neue Entdeckung und eine neue Bewertung der klassischen Antike, die Pflege der lateinischen Sprache und die Erschließung alter, verloren geglaubter Wissensbestände;
-
spezifische für den nordeuropäischen Humanismus waren die Wiederentdeckung der eigenen Vergangenheit und die Ausformung einer nationalen Identität lokalisiert werden. Als Beispiel sei auf die Germania des Tacitus verwiesen, die im Mittelalter nur in einer einzigen Handschrift überlebt hatte und nun durch den Humanisten Jakob Wimpfeling eine neue Würdigung erfuhr;
-
der Humanismus bereicherte nachhaltig den noch jungen Buchmarkt, vor allem durch eine Vielzahl von Editionen oder Neuausgaben verloren geglaubter Bücher;
-
Und: er orientierte sich an der alten Christenheit sowie deren Frömmigkeit und beförderte dergestalt Kritik an der vorbefindlichen Institution Kirche.
3: Kirche, Frömmigkeit und Theologie
3.1: Die Kirche
-
Karikatur eines Mönchs. Holzschnitt von Hans Sebald Beham, 1521
Spätmittelalterliches Papsttum
Im späten Mittelalter durchlebte das Papsttum eine der düstersten Epochen seiner Geschichte. Papst Nikolaus V. (1447-1455) war eine Ausnahme auf dem Stuhle Petri, wenn er sein Amt nicht zur Sicherung und Steigerung familiärer Macht nutzte, sondern auch um dem in Misskredit geratenen Papsttum neue Reputation zu verschaffen. Mit der Zeit seines Pontifikats verbindet sich der Abschluss des Wiener Konkordats (1448), die innere Konsolidierung Italiens (Friede von Lodi 1454/55) sowie die Pazifizierung Roms durch eine Politik des Ausgleichs zwischen den rivalisierenden Clans. Auf ihn geht auch der Gedanke zurück, das Papsttum als Macht sui generis, als geistliche Macht, mit den Mitteln der Architektur der irdischen Stadt einzuschreiben, die Stadt mithin „als Ganze zum Spiegel eines Amtes, eines Wahrheitsanspruchs, einer Welt- und Lebensordnung umzuformen“. (2)
An diesem Plan Nikolaus V. haben auch seine Nachfolger auf dem Stuhle Petri festgehalten; ansonsten aber setzten sie durchweg andere Prioritäten. Die Päpste jener Zeit – Calixt III. (Borgia), Pius II. (Piccolomini), Paul II. (Barbi), Sixtus IV. (della Rovere), Innozenz VIII. (Cibo), Alexander VI. (Borgia), Pius III. (Piccolomini), Julius II. (della Rovere) und Leo X. (Medici) – entstammten durchweg dem italienischen Hochadel und waren „Muster weltlich-dynastischer Herrschaftsauffassung“. (3)
Der deutsche Episkopat
Cum grano salis wird derselbe Vorwurf auch gegenüber dem deutschen Episkopat erhoben. „Die Bischöfe waren in erster Linie Fürsten, dachten wie Fürsten und lebten wie ihre weltlichen Standesgenossen. Theologisch ungebildet, hatten sie an ihren geistlichen Aufgaben nur wenig oder überhaupt kein Interesse“ – so ein Votum aus der älteren Literatur. (4) Erstaunlich sei dies im übrigen nicht, denn:
-
der Episkopat rekrutierte sich bis auf verschwindend geringe Ausnahmen aus dem Adel
-
die deutschen Bischöfe waren zugleich auch Reichsfürsten (ottonisch-salisches Reichskirchensystem), d.h. sie vereinigten kirchliches Amt und weltliche Herrschaft in einer Hand.
Insofern seien also kirchliche Missstände ebenso „systembedingt“ wie das Reformversagen des Episkopats, das sowohl Zeitgenossen wie auch Forschung der kirchlichen Elite der Reichskirche bescheinigen.
In dieser Pauschalität wird sich grundsätzlich berechtigte Kritik am deutschen Episkopat allerdings nicht halten lassen. Dagegen sprechen vor allem die zahlreichen Diözesansynoden, die im späten Mittelalter vielfach bezeugt sind, sowie die Tatsache, dass zahlreiche Bischöfe sehr wohl kirchenreformerisch tätig wurden. Der Fokus ihrer Aktivitäten lag allerdings zumeist im Bereich der Klöster (vielfach der Frauenklöster) und ging in aller Regel mit Bestrebungen einher, den Einfluss der geistlichen Fürsten zu mehren. Zudem waren ihre Handlungsmöglichkeiten vielfach beschränkt, vor allem, weil das sich verfestigende Kirchenregiment der weltlichen Herrscher dem reformerischen Handeln der Bischöfe enge Grenzen setzte. Ohne die Einwilligung der mächtigen Landesherren waren sie gleichsam handlungsunfähig. Infolgedessen verengte sich der Raum, in dem die Bischöfe handelnd auftreten konnten, zusehens auf ihren Herrschaftsbereich als Landesfürsten, das Hochstift.
Der Klerus (Welt- und Ordensgeistliche)
Die Welt der Bischöfe, wie auch die der Körperschaften, die die Bischöfe wählten, also die Domkapitel, war eine Adelswelt. Ihre Welt wa vor allem in sozialer Hinsicht geschieden von der Welt aller anderen Geistlichen, die den übrigen Gruppen der Bevölkerung entstammten. Ein sozialer Aufstieg in die höchsten Ränge der kirchlichen Hierarchie war grundsätzlich möglich, de facto allerdings eher selten.
Dieser niedere Klerus lässt sich wie folgt charakterisieren:
-
er unterlag qua Kirchenrecht der Ehelosigkeit, musste sich also stets neu rekrutieren;
-
um als Kleriker aufgenommen werden zu können, waren eheliche Geburt, Gesundheit sowie ein einwandfreier Lebenswandel erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen war eine Weihe zum Kleriker nicht möglich;
-
zum Wissen eines Klerikers (das abgesehen von den Orden via Schulbildung bzw. „Lehrzeit“ bei einem Priester erworben und durch eine Prüfung nachgewiesen wurde) gehörten Lesen und Schreiben, Lateinkenntnisse (wegen der Messe) und liturgische Kenntnisse (Gesang) sowie ein Grundwissen über die Glaubensinhalte;
-
Universitätsabsolventen waren unter dem Niederklerus ausgesprochen selten. In den Diözesen Chur und Straßburg etwa ist für das späte Mittelalter nur ein Doktor der Theologie nachgewiesen. Ein Universitätsgrad berechtigte den Zugang zu den besseren Pfründen;
-
die Kleriker waren zum Tragen des geistlichen Kleides und zu standesgemäßem Lebenswandel verpflichtet, Inhaber der höheren Weihen zudem zum Breviergebet und zum Zölibat;
-
zu den wichtigsten Privilegien aller Kleriker gehörten der besondere Gerichtsstand (privilegium fori) und die Freiheit von ungeistlichen Tätigkeiten (Kriegsdienst) sowie weltlichen Steuern (privilegium immunitatis)
Dieser niedere Klerus war alles andere als homogen: Es gab Inhaber gut dotierter Pfründen, die vielfach gar nicht vor Ort residierten und die geistlichen Amtspflichten ausübten, sondern den Ertrag in Abwesenheit bezogen und die Amtspflichten von einem schlecht besoldeten Vertreter wahrnehmen ließen. Und es gab – auch infolge der zahlreichen Mess- und Altarstiftungen – Geistliche, die an der Grenze des Existenzminimums existierten, ein regelrechtes klerikales Proletariat. Die vielfach bezeugte Wahrnehmung und Ausübung des Geistlichen Amtes als einer „bloßen Einnahmequelle“ war also nicht nur eine Frage der Mentalität, sondern eben sosehr Ausfluss ökonomischer Zwänge.
Dem Weltklerus standen die Angehörigen der Orden gegenüber, die Mönche und Nonnen. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie sich durch Gelübde zu einem Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam nach bestimmten Regeln in besonderen Häusern verpflichtet hatten. Das spirituelle und theologischen Spektrum der monastischen Gemeinschaftsformen war ausgesprochen breit, nicht nur aufgrund der Vielfalt der Orden, sondern auch, weil sich innerhalb der Ordensgemeinschaft vielfach unterschiedliche Richtungen ausformten. Insbesondere die Mendikantenorden kannten mit Observanten und Konventualen eine strenge und eine minder strikte Richtung. Was sie schied, war die unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft, Reformen gerade auch im eigenen Lebens- und Wirkungsbereich zuzulassen – eine sensible Thematik, die auch innerhalb des Ordensgefüges vielfach zu Spannungen führte.
Die Orden beschränkten sich also keineswegs nur darauf, ihr traditionelles monastisches Leben zu kultivieren; sie öffneten sich vielmehr für jenen Ruf nach innerkirchlichen Reformen, der im ausgehenden Mittelalter dringlicher wurde und auch vor den Klostermauern nicht haltmachte. Dies gilt auch für die in Grafschaft bzw. Herzogtum Württemberg mit großen Niederlassungen vertretenen Orden, die Zisterzienser (Bebenhausen, Herrenalb, Königsbronn, Maulbronn), die Prämonstratenser (Adelberg) und insbesondere die Benediktiner (Alpirsbach, Anhausen, Blaubeuren, Hirsau, Lorch, Murrhardt, St. Georgen und Zweifalten), des weiteren die Bettelorden mit Niederlassungen unter anderem in Stuttgart (Dominikaner), Tübingen (Augustinereremiten) und Franziskaner (Leonberg, Tübingen). Auch in diesen Orden drangen, - zumal unter dem Einfluss der württembergischen Landesherren, Reformer auf ein neues Ethos und eine verinnerlichte Frömmigkeit. Bei allen Erfolgen reichte ihre gestalterische Kraft aber nicht aus, um jener Öffnung zur Welt dauerhaft entgegenzuwirken, die an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert insbesondere die meisten Benediktinerklöster erfasste und die „mit strenger Mönchsaskese kaum noch zu vereinbaren war“. (5)
Die Welt der Kleriker und die Welt der Laien
Die Welt der Kleriker und der Laien war in vorreformatorischer Zeit rechtlich klar geschieden: Dies gilt sowohl für Personen, wo zwischen Klerikern (Geistlichen) und Laien sorgsam unterschieden wurde, als auch für Sachen, wo die Trennungslinie zwischen geistlichen und weltlichen Gütern (Spiritualia vs.Temporalia) lief.
Diese Dichotomien waren konstitutiv für die spätmittelalteliche Kirche und Gesellschaft. Sie gewährleisteten den Vorrang des Klerus als erstem Stand der Gesellschaft und Vermittler des göttlichen Heils in ein – als Folge des Sündenfalls – unvollkommenes Diesseits; sie waren aber auch juristisch relevant und Quell- und Urgrund einer endlosen Zahl von Konflikten zwischen Geistlichen und Laien.
3.2: Spätmittelalterliche Frömmigkeit: Forschung, Gottesdienst und Kirchenbau
Forschung
Lange Zeit wurde das Bild der Kirche im Mittelalter in düsteren Farben gemalt. Zumal das späte Mittelalter galt, vor allem in kirchengeschichtlicher Hinsicht, als ein Zeitalter des Niedergangs und Verfalls. Die heutige Forschung setzt die Akzente anders: Sie betont die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit der religiösen Kultur im späten Mittelalter, auch in Deutschland. Zwar ist unstrittig, dass es im hochdifferenzierten Erscheinungsbild der spätmittelalterlichen Kirche „Dekadenzmomente“ (Kaufmann) gab – verwiesen sei etwa auf das Erscheinungsbild des Renaissancepapsttums, den Fikalismus der Kurie oder die Korruption der klerikalen Eliten. Zum Gesamtbild einer Krise der Kirche im späten Mittelalter fügt sich dies aber nicht. Stattdessen dürfte der spätmittelalterlichen Kirche erhebliche Integrationskraft zu bescheinigen sein – auch deshalb, weil sie es vermochte, Vielfalt zu beheimaten. Nicht nur in der Theologie, sondern auch in der Frömmigkeit war Raum für Verschiedenes, selbst sich Widersprechendes.
Kirchlichkeit: Gottesdienst und Kirchenbau
Im Zentrum des religiösen Heilsangebotes des späten Mittelalters standen der Messgottesdienst und die traditionelle Sakramentsversorgung durch den Ortsgeistlichen. Vor allem auf dem Land bildeten sie vielfach die „alternativlose Grundform der religiösen Praxis“. (6) In den Städten, vor allem in den wirtschaftlich prosperierenden Städten mit ihren sich entfaltenden bürgerlichen Lebenswelten, war die religiöse Kultur des späten Mittelalters ungleich reichhaltiger. Infolgedessen gab es religiöse Phänomene, die in Stadt und Land gleichermaßen beheimatet waren, als auch Manifestationen, die ausschließlich oder zumindest vornehmlich in den (reicheren) Städten anzutreffen waren. Dies gilt etwa mit Blick auf die kirchliche Bautätigkeit.
In keiner früheren Epoche der Kirchengeschichte wurden so viele Kirchengebäude, Kapellen und Altäre (mit Meßstipendien für Altaristen, also Geistliche niederen Standes, die für das Seelenheil ihrer Stifter und deren Angehörige das eucharistische Opfer darbrachten) errichtet wie im späten Mittelalter. Dies gilt für Stadt und Land. Vor allem in der Stadt aber entstanden nicht nur neue, sondern auch besonders prunkvolle Kirchenbauten: In Reutlingen wurde die Marienkirche 1434 vollendet, die Esslingen nach fast zweihundertjähriger Bautätigkeit die Frauenkirche 1520 (Bauzeit: 1321-1520); in Herrenberg erfuhr die Stiftskirche, ein 1336 begonnener Bau, ab 1439 eine grundlegende Erweiterung, in Gmünd die Heiligkreuzkirche (1351-1410), in Ulm das Münster (ab 1377), in Geislingen die Marienkirche (ab 1424), in Öhringen, Stuttgart und Tübingen die Stiftskirchen (Öhringen: 1454-1491; Stuttgart: ab 1436; Tübingen: ab 1470).
In diesen städtischen Kirchen war Raum für die Entfaltung einer immens reichen Kunst, die um 1500 ihren Zenit erreichte: Dies gilt für die plastische Kunst ebenso wie für Wand- und Glasmalerei, die Bilder, prunkvolle Altäre, die vereinzelt aufkommenden Orgeln oder die kirchlichen Gerätschaften. Gerade unter künstlichen Gesichtspunkten war die Zeit um 1500 ein Höhepunkt des Schaffens. In den damals entstandenen Werken spiegelt sich „ungetrübte Kirchlichkeit“ (Kaufmann). Dies gilt unbeschadet dessen, dass die teils von bedeutenden Künstlern stammenden Kunstwerke naturgemäß nicht nur religiöse Hingabe, sondern auch privatem, städtischem oder fürstlichem Standesbewusstsein bzw. Repräsentationsbegehren Rechnung trugen.
Die rege Bautätigkeit des späten Mittelalters ist ein Anzeichen für kirchlich gebundene Frömmigkeit – ebenso wie das fast völlige Verschwinden dissentierender Religiosität (Ketzereien). Andere Indizien unterstreichen den Befund, dass die Kirche hohes gesellschaftliches Ansehen genoss: Zu verweisen wäre etwa auf das Stiftungswesen oder die vielerorts sprunghaft steigende Zahl der Bruderschaften. Zugleich manifestiert sich in ihnen ein Grundzug spätmittelalterlicher Religiosität – die Veräußerlichung von Frömmigkeit.
3.3: Veräußerlichung von Frömmigkeit: Stiftungswesen, Heiligenvereehrung ...
Stiftungswesen
In Köln, das um 1500 mit 40.000 Einwohnern zu den größten deutschen Städten gehörte, wurden von einer in die Tausende gehenden Zahl meist schlecht besoldeter Geistlicher mehr als 1.000 Messen täglich zelebriert. „Kaum eine Stunde, ja Minute des Tages verstrich, in der nicht irgendwo in einer Stadt ein Seelengeläut erklang, das unblutige Meßopfer auf einem Altar dargebracht, Kerzen gestiftet und zu frommen Zwecken abgebrannt, Litaneien gesungen oder die Absolution gespendet wurden“. (7) In dieser gigantischen Zahl gelesener Messen manifestierte sich ein durch die aufblühenden Städte, Zentren von Handel und Kommerz, beförderter Grundzug spätmittelalterlicher Frömmigkeit: das Verhältnis des Menschen zu Gott wurde quantifiziert und berechnet. Es konnte geradezu einer merkantilen Tauschlogik eingeschrieben werden, deren Sinn darin bestand, dass der Mensch am Ende seines Lebens (nur) etwas haben und vorweisen können müsse, um die Seligkeit zu erwerben. Materielles (z.B. Stiftungen) oder Immaterielles (verdienstvolle Werke) kam hierfür gleichermaßen in Frage; beides ermöglichte jenen seligen Handel, in dem Irdisches gegen Himmlisches, Zeitliches für Ewiges getaucht wurde. Erst Luther brach mit dieser Kaufmannslogik und setzte ihr das pure Beschenktwerden ohne Vorleistung entgegen: der göttlichen Gnadenreichtum des Heils werde dem Menschen „umbsonst und on verdienst“ zu Teil.
-
Siegel zur Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217
Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1)
Heiligenverehrung
Das Bestreben, sich des Heiligen zu versichern, zeigt sich auch an der im späten Mittelalter stetig wachsenden Zahl der Heiligen. Nachgefragt war weniger ihre Bedeutung als nachahmenswerte Vorbilder wahrer christlicher Nachfolge denn ihre Funktion als Interzessoren, als Bittsteller für irdisches wie jenseitiges Wohlergehen. Besonders offenkundig zeigt sich dies in der Verehrung der 14 Nothelfer, der im 15. Jahrhundert aufblühte, hatte man doch in ihnen nahezu alle Fälle menschlicher Not ein Konsortium himmlischer Unterstützer zur Verfügung.
Besondere Wertschätzung im Heiligenhimmel des späten Mittelalters wurde der heiligen Anna als Mutter Marias und insbesondere der Gottesmutter selbst entgegengebracht. Die vielfältigen Deutungs- und Hilfsansprüche, die mit ihr verbunden waren, spiegeln sich auch in der Vielfalt der bildlichen Darstellungen, die von der Schutzmantelmadonna über die Himmelskönigin bis zur schlichten Bürgersfrau reichen. Sie dokumentieren nicht nur die ungewöhnliche Intensität und Vielschichtigkeit der Marienfrömmigkeit, sondern auch die Bedeutung von Ehe und Familie im Wertekanon zumal der bürgerlichen Lebenswelt.
-
Flugblatt mit einem Ablassprediger. Holzschnitt von Jörg Breu d.Ä, 1530
Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett
Ablass
Im Ablass, einem allgegenwärtigen und zentralen Element der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur, erreichte die Quantifizierung und Berechenbarkeit des Verhältnisses zu Gott ihren Zenit. Grundlegende theologische Basis war die Annahme, Bußstrafen (poena) könnten gegeneinander ausgetauscht werden, sofern sie nur „tarifgemäß“ äquivalent seien (d.h.: bestimmte Vergehen wurden mit bestimmten Satisfaktionsleistungen geahnet, die ihrerseits durch adäquate Ablässe kompensiert werden konnten). Eine ganze Reihe von Faktoren beförderte die Blüte des Ablasswesens im späten Mittelalter, insbesondere die in der Theologie des 13. Jahrhunderts voll ausgebildete Theorie des kirchlichen Gnadenschatzes. Ihr zufolge waren die Verdienste Christi zusammen mit den überschüssigen Verdiensten der Heiligen der Kirche anvertraut und in der Verfügungsgewalt des Papstes. Der Kommerzialisierung des Ablasses, die keineswegs nur zugunsten der Kurie erfolgte, leistet dies Vorschub, zumal es durch neue Formen des Ablasses (sogenannte Ad-instar-Ablässe) es möglich wurde, Ablässe, die ursprünglich mit bestimmten Wallfahrtsorten verbunden waren, auch auf andere Orte zu übertragen. Herausragende Heilsangebote konnten nun an bestimmten Festtagen auch „in der Nähe“ erworben werden – was die Zahl der Wallfahrtsorte ebenso vermehrte die Konkurrenz der darüber verfügenden geistlichen Orte und Einrichtungen auf dem umkämpften Markt der Heilsangebote.
-
Wallfahrt nach Niklashausen. Holzschnitt, 1493
Wallfahrten und Heiltumsschau
Wallfahrten gehören zu den überkommenen, von alters her praktizierten Formen christlichen Frömmigkeitspraxis. Unternommen wurden sie meist als individuelle Buß- oder Dankesleistung für begangene Schuld bzw. widerfahrene Gnaden oder als Einlösung eines eingegangenen, verpflichtenden Gelöbnisses.
Charakteristisch für das späte 15. und frühe 16. Jahrhundert waren vor allem zwei Tendenzen: Pilgerreisen der politischen Elite ins Heiligen Land, z.B. des Pfalzgrafen Ottheinrich (1521) oder des württembergischen Herzogs Eberhard im Bart (1445-1496, reg. 1459) bereits im Jahre 1468. Und: Wallfahrten entwickeln sich zu einem Phänomen der kollektiven religiösen „Eventkultur“ (Kaufmann), einschließlich der dazugehörigen Formen der Werbung und Vermarktung.
Hervorgerufen wurde diese Eventkultur in aller Regel durch aktuelle Manifestationen wunderbarer Art. In Crailsheim entdeckte ein Hirte eine (einer Buche entspringenden) Quelle, deren Wasser heilende Kraft für sich eintrübende Augen zugeschrieben wurde, in Bopfingen wurden einer Reliquie des Hl. Blasius zahlreiche wundertätige Heilungen zugeschrieben und in einem Mirakelbuch festgehalten. Den sich mehrenden religiösen Manifestation entsprach die sich mehrende Zahl der Wallfahrtsorte: So kannte die Reichsstadt Ulm nicht weniger als vier wundertätige Marienbilder, die in vier über die Stadt verteilte Kapellen aufzufinden waren. Die Reichsstadt Schwäbisch Hall umzog ein förmlicher Kranz von Wallfahrtsorten: der Kapellenturm, die Kirchen zu Rieden (1456), Schuppach (1466), Einkorn (1472), Enslingen (1497). Auch andernorts lassen sich im späten Mittelalter neu aufgekommene Wallfahrtsorte nachweisen, so etwa die Dreifaltigkeitskirche bei Spaichingen, die Herrgottskirche in Creglingen (1384), die Kirche zu Neusaß (vor 1400), Heerberg bei Lauffen (um 1400), Laudenbach (1412), Öhringen (1457), Kerkingen (1472), Ebnat und Ave Maria bei Deggingen im Filstal (1480), Heslach (1497), Mulfingen (1511) oder das Weggental bei Rottenburg (1517). Als die Reformation 1534 im Herzogtum Württemberg eingeführt wurde, gab es nicht weniger als 44 Wallfahrtsorte im Land.
Nicht alle Wallfahrtszentren überregionaler oder regionaler Bedeutung verdankten ihre Bedeutung mirakulösen Ereignissen. Vielfach beruhten Attraktivität und Anziehungskraft bestimmter Orte auch auf Heiltumsschauen (d.h. der Präsentation von Reliquien zu bestimmten Terminen gemäß einer exakt festgelegten Dramaturgie). Diese Heiltumsschauen können als eine Ausdrucksform veräußerlichter Religiosität verstanden werden, die sich durch Akkumulation einzelner Heilsgnaden Heilsgewißheit zu verschaffen suchte und eben deshalb die Kritik der Reformation evozierte; allerdings sollte darüber nicht gänzlich vergessen werden, dass über die Heiltumsschauen auch die Heilsgeschichte vergegenwärtigt und in ihrer Bedeutung für das eigene Heil erlebbar wurde. „Authentisch im Sinne der Zuverlässigkeit oder Wahrscheinlichkeit ihrer Historizität mussten die Objekte“ – z.B. ein Splitter vom Kreuz Christi – „nicht sein, um ihre performative Kraft entfalten zu können“. (8) Auf eben diese performative Dimension zielten auch Inszenierungen während des Gottesdienstes, so etwa die Sitte des Kindleinwiegens an Weihnachten, der Grablegung am Karfreitag, der Auferstehung am Ostermorgen, das Hinaufziehen einer Christusstatue zur Decke der Kirche am Himmelfahrtstag oder das Herablassen eines Heiligen Geistes von der Wölbung des Chores am Pfingstfest. Und auch die geistlichen Schauspiele gehören hierher – die Osterspiele oder die Fronleichnamsprozession, die etwa in Künzelsau 1477 als dramatische Darstellung biblischer Geschichte dargeboten wurde.
3.4: Verinnerlichung von Frömmigkeit: Devotia moderna, Prädikaturen ...
Diametral zu den bisher beschriebenen Erscheinungsformen einer veräußerten Frömmigkeit ist die Tendenz zur Verinnerlichung von Frömmigkeit, die immer weitere Kreise erfasste. Ihr Ursprung im monastischen oder semimonastischen Milieu reicht mindestens ins 14. Jahrhundert zurück und war stark von mystischen Traditionen geprägt. Im 15. Jahrhundert waren Formen verinnerlichter Frömmigkeit, befördert durch Entwicklungsstränge in der akademischen Theologie, in bislang unbekanntem Maße auch bei Laien anzutreffen, vor allem im städtischen Lebensraum.
Devotia moderna
Die seit ca. 1420 so bezeichnete Devotio moderna war die wohl bedeutsamste Frömmigkeitsbewegung des 15. Jahrhunderts. An ihrem Anfang stand der niederländische Laienprediger Gerhard (Gerd) Groote (1340-1384). Nach seinem Bekehrungserlebnis und anschließender Predigttätigkeit, die stark auf Bekehrung und Buße abstellte, gründete er eine von den mystischen Traditionen (insbesondere Johannes Tauler) beeinflusste neue Gemeinschaft von Laien, aus denen die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben hervorgingen. In den 100 Jahren zwischen 1380 und 1480 wurden allein in den heutigen Niederlanden mehr als zweihundert Brüder- und Schwesternhäusern gegründet. die vor allem unter Frauen beliebte Bewegung verbreitete sich zudem rasch in Nord(west)- und Mitteldeutschland, später auch im Rheinland und im damaligen Herzogtum Württemberg. Gefördert durch Herzog Eberhard im Bart unterhielten sie in Urach, Dettingen, Herrenberg, Tachenhausen und auf dem Einsiedel Niederlassungen, ohne jedoch im Lande wirklich Fuß fassen zu können.
Die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben einte der Wunsch, in der Nachfolge der apostolischen Urgemeinde ein entschieden christliches Leben in der Welt leben wollten. Sie praktizierten Gütergemeinschaft, lebten vom Ertrag ihrer Arbeit, übten sich im freiwilligen Gehorsam unter gemeinschaftlichen Ordnungen, kannten gegenseitige (brüderliche bzw. schwesterliche) Ermahnungen, meditierten vorzugsweise über biblische Stoffe und orientierten sich in innerlich vertiefter Weise an der Nachfolge Christi. Sie rezipierten nicht nur Bücher erbaulichen Inhalts – allen voran die Thomas von Kempen (1379/80-1471) zugeschriebene Imitatio Christi –, sondern betrieben vielfach auch eigene Druckpressen, über die sie zur Verbreitung der Bibel in der Volkssprache beitrugen.
„Modern“ war diese Fömmigkeitsbewegung vor allem, weil sie sich zur religiösen Erfahrung hinwandte, die grundlegende Dichotomie von Kleriker und Laien relativierte und weil sie in bislang unbekanntem Maße die religiöse Bildung der Laien förderte.
Prädikaturen, Predigt und Erbauungsliteratur
Eine eminent bedeutsame, weil auch für die Reformation anschlussfähige Entwicklung der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur ist in der wachsenden Bedeutung der Predigt zu lokalisieren. In ihr spiegeln sich die gestiegenen Bildungsansprüche insbesondere städtischer Laien, ihr Verlangen nach kompetenter Erklärung und selbständiger, kognitiver wie affektiver Aneignung der Glaubensinhalte. Die Predigt war daher, zumal im städtischen Lebensraum, ein unabweisbares Bedürfnis, das den Messgottesdienst des Pfarrers ergänzte und von einem eigenen „Personal“, den Prädikaten, wahrgenommen wurde – meist hochqualifizierte Geistliche mit akademischem Hintergrund. In der Regel wurden die Wirkungsstätten der Predikanten, die Prädikaturen, vom städtischen Rat geschaffen und finanziert. Ihm – und nicht dem Bischof – kam infolgedessen auch das Recht zu, die Stellen zu besetzen.
Am Vorabend der Reformation waren die Prädikaturen vielfach mit Geistlichen besetzt, die sich der neuen Lehre zuwandten. In Schwäbisch Hall etwa wirkte Johannes Brenz, in Reutlingen Matthäus Alber, in Ulm Konrad Sam, in Biberach Bartholomäus Müller, in Isny Konrad Frick. Geistlichen wie ihnen war es auch zu verdanken, wenn eine Sonderform des Gottesdienstes, der Prädikantengottesdienst – ursprünglich ein Teil der Messfeier – in veränderter Form in die Reformation Eingang fand und bis heute den Gottesdienst unserer Landeskirche prägt.
Mit den Prädikaturen entstand auch ein baugeschichtlich neues Element: die Kanzel bzw. die predigstül. Im Italien des 12. Jahrhunderts aufgekommen, wurde sie ab dem beginnenden 14. und verstärkt seit dem 15. Jahrhundert auch in Deutschland heimisch. Dem Ende des 14. Jahrhunderts entstammen die ersten in Verbindung mit Langhauspfeilern errichteten Kanzeln, deren Treppen sich um den Pfeiler winden und mit figürlichem Relief- und Statuettenschmuck ausgestattet waren, die Kanzeln im Ulmer Münster und in St. Kilian zu Korbach; im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts entstehen dann die ersten Kanzeln mit figürlichen Füßen (z.B. in der Marbacher Alexanderkirche und der Öhringer Stiftskirche) bzw. mehrgliedrigem Stützsystem (Straßburger Münster).
Für das württembergische Neckargebiet, über das wir dank einer jüngst erschienen kunstgeschichtlichen Dissertation besonders gut informiert sind, sind zwischen 1449 und 1530 Kanzeln in zahlreichen Kirchen dokumentiert: Lorch, Murrhardt, Stuttgart, Marbach, Rottweil, Ditzingen, Mühlacker-Lienzingen, Waiblingen, Öhringen, Freiberg-Heutigsheim, Königsbach-Stein, Leonberg-Eltingen, Stifts- und Augustinerkirche in Tübingen, Eutingen, Stuttgart-Obertürkheim, Ludwigsburg-Eglosheim, Brackenheim-Hausen, Urach, Boll, Schorndorf-Weiler, Herrenberg, Wildeberg-Efringen, Frickenhausen, Weissacht-Flacht, Bietigheim, Esslingen, Kusterdingen, Wimpfen am Berg, Sulz/ Neckar, Magstadt, Remshalden-Hebsack, Balingen, Gingen/ Fils, Schwaigern, Winnenden-Birkmannsweiler, Weilheim/ Teck, (Bietigheim-)Bissingen, Denkendorf, Brackenheim-Stockheim, Rosenfeld-Isingen, Mössingen, Märkgröningen-Unterriexingen, Murr a.d. Murr, Schwaigern-Niederhofen, Affalterbach, Gemmrigheim und Ofterdingen.
In manchen Strömungen der spätmittelalterlichen Theologie konnte der Predigt ein ausgesprochen hohen Stellenwert eingeräumt werden. Johannes Eck etwa, bekannt als einer der schärfsten Widersacher Luthers, war der Auffassung, dass, „wer eine Predigt andächtig anhöre … ein ebenso gutes Werk tue wie ein Kartäuser, der sich geißle“. (9) Die Laien konnten also in ihrem Heilsbemühen zu den religiösen Virtuosen, für die stellvertretend der als besonders elitär geltende Kartäuserorden genannt wurde, aufschließen. Ihre Leistung war in der Heilsökonomie nicht weniger wert als ein idealiter asketisches mönchisches Leben. Aus reformatorischer Sicht war freilich das Geißeln des Karthäusers wie das Hören einer Predigt insofern ungenügend, als beides als Werk, als gutes Werk, qualifiziert wurde und damit der theologischen Prämisse geschuldet war, dass der Mensch – und sei es auch in bescheidenstem Maße – an seinem Heil mitzuwirken habe.
Was gepredigt wurde, entzieht sich vielfach unserer Kenntnis. Die überlieferten Predigten des ausgehenden Mittelalters lassen aber den Schluss zu, dass ein breites Spektrum dargeboten wurde. Da die Prädikanten sich meist der Frömmigkeitstheologie verbunden wussten, dürften ihre Predigten deren zentrale Anliegen aufgegriffen haben – die Betonung der Gnade und Liebe Gottes einerseits, die Forderung an die Gläubigen, dem im eigenen Lebensvollzug gerecht zu werden, andererseits. Eminent bedeutsam war infolgedessen die Christus- und Passionsfrömmigkeit, weil sie Gottes Erbarmen erfahrbar machte. Ihr wurde hohe Aufmerksamkeit gezollt – von Predigern wie Zuhörern. In bestimmten Kontexten konnte der leidenden Christus bereits im 15. Jahrhundert in „eine religiöse Schlüsselposition“ (Kaufmann) rücken und damit einen religionskulturell bedeutsamen und folgenreichen Kontrapunkt zu jenen Tendenzen in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit setzen, die andere Zugänge zu Gnade und Heil fokussierten, etwa in Form der populären Marienfrömmigkeit oder des vielgestaltigen Heiligenhimmels. Jene Konzentration auf die Alleinwirksamkeit Gottes im Heilsgeschehen, der die Reformatoren das Wort redeten, blieb dem späten Mittelalter allerdings fremd.
Gedruckte Predigt und Erbauungsliteratur
Dass viele Predigten des späteren 15. Jahrhunderts im Druck auf uns gekommen sind, verweist auf das Bedürfnis der Laien, die Predigt nicht nur zu hören, sondern auch (nach)lesen zu können. Diesem Anspruch trug auch die Erbauungsliteratur Rechnung, die im ausgehenden Mittelalter vermehrt in deutscher Sprache publiziert wurde und damit verfügbar war. Wenn Predigten oder predigtartige Auslegungen biblische Perikopen, sog. Postillen, Hochkonjunktur hatten, dann verweist dies auf einen engen Zusammenhang zwischen Bildung, Frömmigkeit und Medienkultur, einen Zusammenhang, der für die Ausbreitung der Reformation wohl kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Der frommen Lektüre konnte dabei gottesdienstähnliche Qualität zuerkannt werden; zumindest aber vermittelte sie „Einsichten und religiöse Gewißheiten, die das Gottesverhältnis unmittelbar betrafen“. (10)
Die deutschsprachige Erbauungsliteratur ergänzte die lateinischsprachige, sie verdrängte sie nicht. Sie machte vielmehr diesen reichhaltigen Erfahrungsschatz nun auch jenen zugänglich, die zwar lesen konnten, nicht aber die lateinische Sprache beherrschten. Bislang „exklusive“ Wissensbestände und Traditionen einschließlich der Mystik oder klassischen Werken der Erbauungsliteratur wurden nun einem breiteren Publikum zugänglich. Diese Schriften, - unbeschadet ob in lateinischer oder deutscher Sprache verfasst, propagierten nicht nur das Ideal eines einfachen, tugendhaften christlichen Lebens, das – vermittelt durch Traktate, Gebetbücher und fromme Übungen – eingeübt werden sollte und somit einer Frömmigkeitspraxis, einer praxis pietatis, in der Welt das Wort redete; sie trugen in erheblichem Maße auch dazu bei, individuelle Zugänge zum Religiösen zu befördern und damit ein Bedürfnis nach zeitgemäßer religiöser Laienbildung zu befriedigen.
Volkssprachliche Bibeln
Eigens zu verweisen gilt es auf volkssprachliche Bibelausgaben, die seit 1466 neben die lateinischen und damit der gelehrten Elite vorbehaltenen Drucke traten (Straßburger Druck des Johann Mentelin). Nachgewiesen sind 14 hoch- und vier niederdeutsche Volltextausgaben, vielfach illustriert, zudem zahlreiche Teilausgaben. Druckorte waren vor allem Augsburg, Köln, Nürnberg und Straßburg. Deutsche Bibeln waren demnach bereits vor der Reformation durchaus weit verbreitet – und dies bezeugt, „dass es eine entsprechende Nachfrage, ja so etwas wie einen Hunger von Laien nach dem Wort Gottes gegeben hat“. (11)
3.5: Die akademische Theologie des 15. Jahrhunderts
Via antiqua und via moderna
In der akademischen Theologie des 15. Jahrhunderts, wie sie an den Universitäten und in den verschiedenen Orden gelehrt wurde, konkurrierten zwei im Gehäuse der scholastischen Theologie und Methode ausgeformte philosophische und theologische Schulen, die seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert als antiqui und moderni auf den Begriff gebracht wurden. Hinter diesen Bezeichnungen verbargen sich – ursprünglich philosophische, aber für die Theologie folgenreiche – unterschiedliche erkenntnistheoretische Lehren: Die antiqui vertraten im Kern eine realistische Position, d.h. sie billigten abstrakten Entitäten („Ideen“, Allgemeinbegriffen) eine eigenständige Existenz zu und waren deshalb geneigt, Gott an eine vernünftige Weltordnung zu binden, die infolgedessen auch mit Hilfe der eigenen Vernunft erfasst werden könne. Die moderni hingegen optierten zugunsten eines nominalistischen Universalienverständnisses, d.h. sie sahen in Allgemeinbegriffen gedankliche Abstraktionen, denen keine reale Existenz zukomme. Damit war in aller Regel die Betonung der absoluten Macht Gottes verbunden, und mit dieser seine Freiheit, „ungehindert in seine Schöpfung und in den Heilsplan einzugreifen“ (12) – mit weitreichenden Konsequenzen etwa für die Frage, wie die absolute Freiheit Gottes mit seiner Verlässlichkeit für den Menschen zusammengedacht werden könne.
Der Gegensatz zwischen den beiden Wegen, der Via antiqua und der Via moderna, stand im Zentrum der philosophischen Auseinandersetzungen des späten Mittelalters, verlor allerdings im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert erheblich an Bedeutung. Zunehmend existierten beide Schulen an den Universitäten nebeneinander, zunehmend wurden auch humanistische Wissensbestände rezipiert. An der Universität Heidelberg etwa, der ältesten deutschen Universität, war seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert eine moderate Via moderna vorherrschend, ehe 1452 auch die Via antiqua zugelassen wurde. An der jüngeren, erst 1477 gegründeten Universität Tübingen blieb hingegen die Via Moderna tonangebend. Als Lehrstuhlinhaber verfasste hier Gabriel Biel (vor 1410-1495) u.a. seinen großen Sentenzenkommentar, eine (erst von seinem Schüler Wendelin Steinbach vollendete) Sammlung und Zusammenfassung des Denkens und der Lehre des Philosophen und Theologen Wilhelm Ockham (um 1288-1347). Was er in seiner Interpretation des großen, in der englischen Grafschaft Surrey geborenen Theologen hervorhob, war vor allem die Möglichkeit, durch Werke das Heil zu gewinnen – „eine wirkungsgeschichtlich bedeutsame Zuspitzung, insofern Martin Luther vornehmlich nach diesem Werk Theologie studierte und es das Scholastikbild prägte, gegen das er sich 1517 in seiner Disputatio contra scholasticam theologiam wandte“. (13)
Frömmigkeitstheologie
Jenseits der beiden viae gewann im ausgehenden Mittelalter eine theologische Strömung an Bedeutung, für die Berndt Hamm den Begriff der „Frömmigkeitstheologie“ geprägt hat. Für sie stand eine Gruppe von Theologen, vielfach Ordensangehörige, „deren ausschließlich seelsorgerliche Intentionen darauf gerichtet sind, der Ferne zwischen scholastischer Theologie der Universität und Frömmigkeit des Alltags entgegenzuwirken und sich ganz der Anleitung zum rechten Vollzug eines christlichen Lebens, seiner geistlichen Vertiefung und ordnenden Gestaltung, zu widmen“. (14) In der theologischen Landschaft des Jahrhunderts vor der Reformation wurde die theologische Reflexion ganz in den Dienst der Frömmigkeitsformung gestellt und so eng mit der religiösen Lebenspraxis verbunden, meist in gewollter Abgrenzung von einer gelehrten Theologie, die in ihrer von der Philosophie geprägten Gestalt als unnütz und unfruchtbar empfunden wurde. Mit ihrem Drängen auf das für das religiöse Leben der Laien Relevante unterzog sie die reiche scholastische, kanonistische und mystische Tradition einer strengen Auswahl zugunsten einer betont biblischen Theologie, die zur Bibellektüre anleiten und sie zu heilsamen Lebensgestaltung fruchtbar machen wollte. Durch eine dergestalt vereinfachte, dadurch aber reicher und intensiver werdende Theologie sollten die Laien angesprochen werden. Ihnen wurde nunmehr die gleiche geistliche Erfahrungstiefe und die gleiche Intensität an Frömmigkeit zugetraut und zugemutet wie zuvor nur Mönchen und Nonnen. Damit wurden die Ideale geistlicher Lebensformung in die Laienwelt hineingetragen.
Dieses Grundanliegen war allen theologischen Alternativen, die innerhalb der Frömmigkeitstheologie anzutreffen sind, gemeinsam. Deutlich unterschiedliche Positionen wurden hingegen in der Frage bezogen, wie der Mensch sich seines Heils gewiss sein könne: Ihre Pole markieren einerseits der Glaube an jene Heilssicherheit, die von Institutionen garantiert werde (in gnaden- und heilsvermittelnden kirchliche Sakralinstitutionen, in Papst- und Priestertum, Sakramenten und Ablässen, Marien- und Heiligenverehrung, Passionsfrömmigkeit u.ä.), eine Auffassung, die etwa Johann von Paltz vertrat. Ihr gegenüber steht der Glaube an Sicherheit in der unmittelbaren, inneren Begegnung der Seele mit dem Erbarmen Jesu Christi, für das etwa Luthers Ordensvorgesetzer und Beichtvater, Johann von Staupitz, eintrat.
Spätmittelalterliche Frömmigkeitstheologie und Reformation
Die spätmittelalterliche Frömmigkeitstheologie kennt somit Ansätze zu dem, was Berndt Hamm als normative Zentrierung bezeichnet hat, d.h. eine Ausrichtung auf die wahre Buße bzw. wahre Reue des Menschen einerseits und die barmherzige Gerechtigkeit bzw. gerechte Barmherzigkeit Gottes andererseits, die vom Leiden Christi her verstanden werden. Aber: auch in jenen Strömungen der Frömmigkeitstheologie, welche die Barmherzigkeit und nahe Gnade Gottes betonen, „bildet die Barmherzigkeit immer nur den einen Brennpunkt im Gegenüber zum anderen Brennpunkt in Gestalt der wahren Buße, als einer gewissen Qualität und Moralität auf Seiten des Menschen, die dem Anspruch der göttlichen Gerechtigkeit genügt“. (15) Eben dies ändert sich mit der Reformation. Indem sie ganz auf Gott verweist, entfällt der auf dem Menschen lastende Zwang, zu seinem Heil aktiv betragen zu müssen, in welch rudimentärer Form auch immer.
3.6: Krise der Kirche am Ausgang des Mittelalters?
Die verdienstvolle und noch heute lesenswerte, vom Calwer Verlagsverein 1893 herausgegebene württembergische Kirchengeschichte beschreibt das 14. und 15. Jahrhundert als „Verfall der mittelalterlichen Kirche und Anbahnung der Reformation“. Dies wird heute nicht mehr so gesehen, weder in der allgemeinhistorischen noch in der kirchengeschichtlichen Forschung. Statt dessen wird unbeschadet aller krisenhafter Momente, die zumal im Bereich der kirchlichen Hierarchie, der kirchlichen Amtsträger und der kirchlichen Finanzen zu konstatieren sind, hervorgehoben, dass „die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der Religionskultur um 1500 nicht von der Art war], dass sie auf eine Ende gedrängt und des erlösenden Abbruchs durch den Umbruch der Reformation bedurft hätte“. (16) Um 1500 war die alte Kirche unbeschadet aller Kritik, die es (gerade auch in Kreisen der Humanisten gab), nicht ernsthaft in Frage gestellt.
Veröffentlicht am: : 16.04.2014
Aktualisiert am: 16.07.2018
Bildnachweise
-

-
Karl V Kaiserkrönung in Bologna. Gemälde von Juan de la Corte, 1660, Museo de Santa Cruz, Toledo
-

-
Mächtespiel 1515: Die Mächtigen des Reiches pokern um Mailand. Unter den Zuschauern findet sich unter (H) Herzog Ulrich von Württemberg. Unbekannter Meister, um 1515.
-

-
Karikatur eines Mönchs. Holzschnitt von Hans Sebald Beham, 1521
-

- Wallfahrt nach Niklashausen
Wallfahrt nach Niklashausen
Holzschnitt aus der Schedelschen Weltchronik 1493, gemeinfrei
-

-
Siegel zur Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217
Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1)
-

-
Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217
Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1), gemeinfrei
-

-
Flugblatt mit einem Ablassprediger. Holzschnitt von Jörg Breu d.Ä, 1530
Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett
Zitierweise
https://wkgo.de/cms/article/index/der-deutsche-sdwesten-um-1500-politik-gesellschaft-kirche-und-frmmigkeit (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Die Reformation im deutschen Südwesten
-
Inhaltsverzeichnis
- 1: Die Reformation als theologisches und mediales Ereignis
- 1.1: Brennpunkte der Reformation
- 1.2: Initialzündung im deutschen Südwesten: Die Heidelberger Disputation 1518
- 1.3: Die Reformation als mediales Ereignis
- 1.4: Gegner Luthers
- 1.5: Reformation und Öffentlichkeit
- 2: Der Verlauf der Reformation im deutschen Südwesten - Grundzüge
- 2.1: Die Reformation – ein städtisches Ereignis?
- 2.2: Bauernkrieg und Reformation
- 2.3: Außenseiter der Reformation
- 2.4: Eine späte Reformation: Die Reformation im Herzogtum Württemberg
- 3: Die politische Konsolidierung der Reformation
- 4: Institutionalisierung der Reformation – das Beispiel Württemberg
- 4.1: Oberdeutsche oder lutherische Reformation?
- 4.2: Die „Einführung“ der Reformation in Württemberg: Kein Ereignis – ein Prozess
- 4.3: Neubesetzung der Pfarrstellen
- 4.4: Neue Ordnungen für eine neue Kirche
- 4.5: Landesherr und Kirchengut
- 4.6: Kirchenleitung
- 4.7: Die Rechte der Gemeinden
- 4.8: Eine neue Funktion: Klöster als Schulen
- 4.9: Schulwesen, Universität, Stift
- 4.10: Das Interim: Bewährungsprobe der Reformation
- 4.11: Confessio Virtembergica
- 4.12: Das Ende der Reformation in Württemberg
- 5: Theologie und Politik: Das Herzogtum Württemberg 1550 - 1650
- 5.1: Das konfessionelle Zeitalter
- 5.2: Feinbild Katholiken: Reichspolitik und Kontroversliteratur
- 5.3: Innerprotestantische Konflikte und Einigungsbestrebungen
- 5.4: Umgang mit einer äußeren Bedrohung: Türkengefahr
- 5.5: Rekonfessionalisierung der Reichspolitik und Dreißigjähriger Krieg
- Anhang
1: Die Reformation als theologisches und mediales Ereignis
1.1: Brennpunkte der Reformation
-
Martin Luther, Kupferstich nach einer Vorlage von Lukas Cranach
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 11.079
Die Reformation ist zwar nicht nur ein theologisches Ereignis von enormer Reichweite, als solches begann sie aber. Epizentren dieser theologischen Revolution waren das Wittenberg eines Martin Luthers einerseits, das Zürich Huldrich Zwinglis andererseits. Der deutsche Südwesten lag im Windschatten dieser Gravitationszentren reformatorischen Geschehens. Zur Verbreitung und zum Gelingen der Reformation hat er gleichwohl erheblich beigetragen, vor allem dank der Reichs- und freien Städte, in denen die Reformation früh Eingang fand.
Ohne Bedeutung für die frühe Reformation war hingegen die politische Vormacht im deutschen Südwesten, das Herzogtum Württemberg. Entscheidend hierfür war, dass das Land seit der selbstverschuldeten Vertreibung des Landesherrn, Herzog Ulrich, im Jahre 1519 unter habsburgischer Verwaltung stand. Regiert wurde es von Ferdinand von Österreich, dem Bruder Kaiser Karls V., damals noch Erzherzog von Österreich, seit 1531 römischer König. Die Habsburger aber waren aus vielfältigen Gründen der alten Kirche eng verbunden. Es kann daher nicht überraschen, wenn im Gebiet des Herzogtums Württemberg „die“ Reformation nur auf eine verhaltene, kaum wahrnehmbare Resonanz stieß – zumal das Land selbst um 1500 nicht zu den führenden kulturellen Zentren des Alten Reiches zählte. Nicht das Herzogtum, sondern die Reichsstädten des deutschen Südwestens sind infolgedessen als frühe Zentren der reformatorischen Bewegung auszumachen.
1.2: Initialzündung im deutschen Südwesten: Die Heidelberger Disputation 1518
Für den Gang der Reformationsgeschichte im deutschen Südwesten kam der Heidelberger Disputation eine wichtige Bedeutung zu. Disputationen, genauer: öffentliche Disputationen waren ein üblicher Bestandteil von Ordenszusammenkünften, und eine solche, eine Zusammenkunft (sog. Kapitel) der deutschen Augustinerkongregation, hatte der Generalvikar der deutschen Augustinerprovinz, Luthers väterlicher Freund Johannes (von) Staupitz, für den 15. August 1518 in Heidelberg anberaumt.
Die Aufgabe, die Thesen aufzustellen und bei der Disputation am folgenden Tag den Vorsitz zu übernehmen, hatte Staupitz Luther übertragen – wohl auch deswegen, um ordensintern einem drohenden Prozess gegen Luther entgegenzuwirken, der zwangsläufig auf den Gesamtorden zurückfallen musste. Luther ging auf den damals bereits hohe Wellen schlagenden Ablassstreit mit keinem Wort ein, sondern konzentrierte sich ganz auf jene grundsätzlichen Fragen, die auch die Ablassfrage tangierten – die Frage nach der eigentlichen Aufgabe der Theologie.
Was Luther programmatisch entfaltete, war der Gedanke einer theologia crucis, einer Theologie des Kreuzes: Alle Versuche, Gott aus eigenen Mitteln zu suchen, werden konsequent zurückgewiesen und einer fehlerhaften Theologie, einer theologia gloriae, zugeschrieben (These 19). Denn sie sind Ausdruck des menschlichen Bemühens, „durch wie auch immer geartete eigene Werke Gott zu suchen“. Menschliche Werke aber sind in sich Todsünde (These 13), weil der Mensch über einen freien Willen nur sub titulo, dem Namen nach verfüge (These 13), nicht aber faktisch. Stattdessen ist von der vollkommenen Unzulänglichkeit des Menschen im Angesicht Gottes auszugehen. Aufgrund dieser Verfasstheit kann er sich durch eigene Werke schlechterdings nicht erlösen – und eben deswegen ist der Glaube als Reaktion auf Gottes Verheißungswort zentral bedeutsam. Denn der Glaube ist „ganz Geschenk Gottes, das dem Menschen wie und als Gnade selbst eingegossen wird“ (Erläuterung These 25). Gerecht ist daher nicht derjenige, der viel wirkt, sondern der ohne Werke viel an Christus glaubt. Der Zugang zu Gott erfolgt allein im Blick auf den Heiland Jesus Christus, auf seine Wunden.
Mit diesen Ausführungen grenzte sich Luther von der scholastischen Theologie in all ihren unterschiedlichen Schattierungen ab. Zwar konnte er keinen der anwesenden Professoren überzeugen; wohl aber stieß er bei den anwesenden Studierenden auf begeisterten Zuspruch – u.a. bei Johannes Brenz, den späteren Reformator von Schwäbisch Hall, Erhard Schnepf, der in Wimpfen, Hessen und Württemberg tätig werden sollte, dem Ulmer Reformator Martin Frecht sowie der Zentralfigur der oberdeutschen Reformation, Martin Bucer. Auch wenn manche von ihnen später eigene Wege gehen sollten, war für sie alle die persönliche Begegnung mit dem Wittenberger Reformator prägend. „Insofern war Luthers Auftritt in Heidelberg nicht nur ein theologisches Ereignis, sondern ein wichtiges Anfangsdatum der südwestdeutschen Reformation überhaupt“. (1)
1.3: Die Reformation als mediales Ereignis
-
Luther auf dem Reichstag zu Worms, Kolorierter Holzschnitt, 1577
Was die Ausbreitung der Reformation im deutschen Südwesten anbelangt, war die mit ihr einhergehende mediale Revolution weitaus bedeutsamer als das singuläre Ereignis der Heidelberger Disputation. Als wohl wichtigste „Sturmtruppen der Reformation“ (Arnold E. Berger), die das bestehende Kirchenwesens erschütterten, sind die Flugschriften und Flugblätter anzusprechen.
In der Massenhaftigkeit, wie sie mit ca. 5.000 Drucken allein zwischen 1521 und 1525 auftraten, waren sie ein neuartiges Phänomen und ihrerseits Ausdruck der erregten Diskussionen, die namentlich Luther in allen Schichten der damaligen Gesellschaft entzündete. Unter den tatsächlichen wie fingierten Autoren findet sich nahezu das gesamte Spektrum der damaligen Gesellschaft: Kleriker und Laien, Gelehrte und Handwerker, Ritter und Bauern, Fürsten und Könige. Im inhaltlichen- theologischen Profil dieser Druckerzeugnisse, die nicht nur gelesen, sondern auch vorgelesen wurden, war eine apokalyptische Grundstimmung vorherrschend, galt es doch hier und heute für das Evangelium und gegen des „BabstEndchristisch regiment“ Partei zu nehmen. Dementsprechend scharf war der Gegensatz zwischen den Anhängern und Sympathisanten der neuen Lehre und den Papisten ausgeprägt. Inhaltlich stand die Alleingültigkeit der Schrift (sola scritura) im Vordergrund; die Frage der Werkgerechtigkeit, die Neuordnung der Sakramente auf biblischer Grundlagen sowie die mit der Konzentration auf Christus einhergehende Verwerfung der Heiligen waren weitere wichtige Themen.
Wenn sich auch die altgläubige Theologen der neuen medialen Möglichkeiten bedienten, so war insgesamt doch ein erdrückendes Übergewicht der Anhänger der Reformation zu verzeichnen. Die evangelische Seite besaß im Kampf um die öffentliche Meinung die Oberhand (und sollte sie noch für Jahrzehnte behalten). Und: da die Inhalte dieser frühen Flugschriften und anderer Druckerzeugnisse weitestgehend von Wittenberg geprägt wurden, dominierte in der öffentlichen Wahrnehmung unbeschadet den sich bereits abzeichnenden unterschiedlichen „Aneignungsformen reformatorischer Theologie“ (Kaufmann) zunächst das Bewusstsein von der Zusammengehörigkeit aller Evangelischen und ihrer endgültigen Geschiedenheit von der Papstkirche.
1.4: Gegner Luthers
-
Ulrich Zasius (latinisiert Huldrichus), zeitgenössischer Kupferstich
Keineswegs nur die Anhänger Luthers, auch seine Gegner positionierten sich früh. Im deutschen Südwesten wäre etwa auf den Konstanzer Juristen Ulrich Zasius (1461-1535) zu verweisen, der zwar Luthers Kritik am Ablass begrüsste und seine Buß- und Rechtfertigungslehre zu schätzen wusste, aber seine Kritik am Papsttum verabscheute und auch an der überkommenen Sakramentenlehre festgehalten wissen wollte. Zu seinen wichtigsten Schülern zählte Johann Heigerlin aus Leutkirch (1478-1541), genannt Fabri, seit 1518 (bis 1522) Generalvikar in Konstanz. Bereits 1524 wechselte er allerdings als Koadjutor in das Bistum Wiener Neustadt, wo er als Rat Erzherzog Ferdinands Anteil an der Reichsreligionspolitik der 1520er Jahre hatte. Er war einer der kirchenpolitisch und vor allem publizistisch profiliertesten Gegner Luthers – allerdings in Funktionen und Ämtern jenseits des uns interessierenden Raumes.
1.5: Reformation und Öffentlichkeit
Als theologisches Ereignis wurde Luthers Auftreten auch im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation früh und nachhaltig wahrgenommen, erregt und kontrovers diskutiert. Wenn auch Zweifel, Vorbehalte und Kritik an der „neuen Theologie“ geäußert wurden, so beherrschten doch Luther und seine Anhänger den öffentlichen Diskurs um die Reformation. Nichts unterstreicht dies besser als die enorme Zahl der zwischen 1521 und 1530 publizierten Flugblätter und Flugschriften. Sie rahmten und beeinflussten den Prozess der politischen Implementierung der Reformation.
2: Der Verlauf der Reformation im deutschen Südwesten - Grundzüge
2.1: Die Reformation – ein städtisches Ereignis?
-
Die Reichsstadt Reutlingen (hier in einem Stich von 1643) gehörte zu den Erstunterzeichnern der Augsburger Konfession
Die Reformation sei „an urban event“, ein städtisches Ereignis – so die erstmals 1974 formulierte und bis heute wirkmächtige Erkenntnis des englischen Historikers A.G. Dickens. (2) Ihr vorausgegangen war ein zumindest für die deutschsprachige Forschung kaum minder bedeutsames Buch des damaligen Göttinger Kirchenhistorikers Bernd Möller, der 1964 eine besondere Nähe zwischen der genossenschaftlich verfassten Reichsstadt und bestimmten theologischen Strömungen in der reformatorischen Theologie auszumachen glaubte. (3)
Mit Blick auf den deutschen Südwesten scheint alles für die These von Dickens von der „popular and enthusiastic Reformation of the cities zu sprechen: 17 Reichsstädte zählte Südwestdeutschland um 1500 – Biberach, Bopfingen, Dinkelsbühl, Esslingen, Giengen an der Brenz, Isny, Kempten, Konstanz, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Reutlingen, Rothenburg, Rottweil, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Ulm, Weil der Stadt, Wimpfen. Einige von ihnen (kursiv) liegen im Gebiet unserer heutigen Landeskirche. All diese Städte haben ihre jeweils eigene Kirchen- und Reformationsgeschichte. Im 16. Jahrhundert war ihnen allen vor allem eines gemeinsam: Die ungeheure Faszination, die von der neuen Lehre ausging. Bis 1555, dem Jahr des Augsburger Religionsfriedens, waren nicht weniger als 16 dieser Städte den evangelischen Reichsständen zuzurechnen. Besonders früh wandten sich Nördlingen (um 1522), Wimpfen (1523), Konstanz (1526), Kempten (1527), Memmingen (1525/1528), Reutlingen (1524/1531), Isny (1534), Ulm (1524/30), Lindau (1523), Biberach (1531), Esslingen (1531), Heilbronn (1531), Dinkelsbühl (nach 1530), Schwäbisch Hall (1538), Rothenburg ob der Tauber (1544), Bopfingen (1546) der Reformation und verantworteten diesen wagemutigen Schritt auch vor Kaiser und Reich. Nur in wenigen Städten stieß die Reformation auf Widerstand, und nur in einer, in Schwäbisch Gmünd, ist die Reformation bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts definitiv gescheitert. Gerade im deutschen Südwesten findet die These von Dickens von der „popular and enthusiastic Reformation of the cities“ eine eindrucksvolle Bestätigung.
Reichsstadt und Reformation
In dem knappen Jahrzehnt zwischen dem Wormser Edikt des Jahres 1521, in dem Luther in die Acht erklärt wurde, und dem zweiten Speyrer Reichstag des Jahres 1529 waren die Reichsstädte in vieler Hinsicht der „Motor der reformatorischen Entwicklung im Reich“ (Kaufmann). Die Städte waren es, die zuerst darauf verwiesen hatten, das Wormser Edikt nicht einhalten zu können und auch nicht einhalten zu wollen. Auch die berühmte, namensgebende Protestation von 1529, bedingt durch den Beschluss der Reichstagsmehrheit, bereits eingeleitete reformatorische Neuerung bis zu einem zukünftigen Konzil „soviel muglich“ wieder rückgängig zum machen, haben neben den fürstlichen Meinungsführern der neugläubigen Stände, allen voran Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen, ferner Markgraf Georg von Brandenburg- Ansbach, sowie dem Vertreter der Fürsten Wolf von Anhalt und Ernst von Braunschweig-Lüneburg auch 14 Reichsstädte mitgetragen – Biberach, Heilbronn, Isny, Kempten, Konstanz, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Reutlingen, St. Gallen, Straßburg, Ulm, Weißenburg und Windsheim. Indem sie alle sich dagegen verwahrten, sich in religiösen Gewissensfragen Mehrheitsbeschlüssen zu beugen, legten sie erstmals vor der reichischen Öffentlichkeit ein gemeinsames Bekenntnis ihres Glaubens ab. Insofern war es nicht gänzlich unbegründet, wenn später die Speyrer Protestation, - eigentlich ein zeitgenössisches Rechtsinstrument, zur Geburtsstunde des Protestantismus stilisiert wurde.
Reichsstädtische Reformation
Die „Dreh- und Angelpunkte“, an denen sich in den Reichsstädten das Geschick der Reformation vielfach entschieden, waren das Verhältnis zum Reichsoberhaupt, dem katholischen Kaiser aus dem Hause Österreich, das jeweilige regionalpolitische Umfeld, in dem die Städte lagen, sowie die Frage, ob die meist unzulängliche eigene Machtbasis erweitert werden konnte – sei es durch Bündnisse unter den Städten selbst oder durch Bündnisse zwischen glaubensverwandten Fürsten und Städten.
Im innerstädtischen Reformationsprozess selbst lassen sich vielfach zwei Phasen unterscheiden, eine Inaugurationsphase einerseits, und eine und Durchsetzungs- bzw. Institutionalisierungsphase andererseits. Die Inaugurationsphase zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass reformatorische „Ideen“ im städtischen Raum zirkulierten, vor allem dank der neuen Medien und der Tätigkeit reformatorischer Prediger. Letztere spielten meist eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung und theologischen Konsolidierung reformatorischen Gedankenguts, vielfach auch bei seiner politischen Durchsetzung im städtischen Kosmos. Denn um sie formte sich eine reformatorische Bewegung (Scribner), mit deren Unterstützung wichtige Kommunikationsplattformen, vor allem Predigtstühle (-> Prädikaturen), zugänglich wurden. Wie konfliktträchtig der innerstädtische Reformationsprozess verlief, bemaß sich in erster Linie daran an zwei Faktoren:
-
ob die Reformation früh Rückhalt an der die Stadt regierenden Elite fand oder ob die Reformation primär von sozialen Trägerkreisen inauguriert wurde, deen die Beteiligung an der städtischen Herrschaft (bisher) versagt war. Dann verschränkten sich Reformationsprozesse mit innerstädtischen Verfassungskonflikten und politischen Partizipationskämpfen;
-
der Intensität des altkirchlichen Widerstands, der in den meisten Städten von der Elite der Weltgeistlichkeit, nicht von der Ordensgeistlichkeit getragen wurde.
Oberdeutsche Reformation
So unterschiedlich sich die Ausgangslage der Reformation in der Stadt darstellte, so unterschiedlich war demzufolge auch ihr Verlauf. Im Ergebnis allerdings bildete sich in all diesen Städten, mehr oder mindert deutlich konturiert, eine vom mitteldeutschen Luthertum geschiedene eigene reformatorische Theologie heraus, desgleichen andersartige kirchliche Ordnungen. Diese spezifisch städtische Ausformung der Reformation wird als oberdeutsche Reformation bezeichnet, weil sie auf einen Raum beschränkt blieb, der im Norden durch die Linie Esslingen-Ulm-Augsburg, im Osten durch die Linie Augsburg-Kaufbeuren-Kempten, im Westen durch das Elsass und im Süden durch die deutsche Schweiz, mithin Oberdeutschland, begrenzt war. Theologisch kennzeichnete die oberdeutsche Reformation der Widerstand gegen Luthers Auffassung vom Abendmahl und Sakrament sowie eine stärkere Betonung der Heiligung, d.h. der Erneuerung der äußeren Lebensführung im Gehorsam gegen Gottes Gebote im Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft. Konsequenterweise sollte nicht nur die Kirche in ihrem äußeren Erscheinungsbild, in ihrer Verfassung, in ihren Riten grundlegend erneuert, sondern auch der städtische Lebensraum von biblischem Ethos durchdrungen werden. Der Bruch mit der mittelalterlichen Kirche wurde daher besonders radikal und kompromisslos vollzogen: Prozessionen und Wallfahrten wurden abgeschafft, die Bilder beseitigt, die Messe durch eine neue Form des Gottesdienstes ersetzt, die sich an den vorreformatorischen Predigtgottesdienst anlehnte, und in der obrigkeitlichen Sittenzucht ein moralischer Rigorismus institutionell verankert und praktiziert, der sowohl die vorreformatorischen Ansätze als auch vergleichbare Bemühungen im Luthertum bei weitem überbot. Ziel war „die wenigstens in der äußeren Moralität reine, heilige Stadt“ (4), die civitas Christiana zu Ehren Gottes, die „gantze, volle, satte reformation“, wie es der Konstanzer Reformator Ambrosius Blarer einmal formulierte. (5)
2.2: Bauernkrieg und Reformation
-
Bannerträger "Freiheit". Holzschnitt 1522. Thomas Murner ironisierte emblemeatisch die Leitbegriffe der reformatorischen Bewegung "Evangelium", "Wahrheit" und "Freiheit eines Christenmenschen" in drei aufgeblasenen Bannerträgern.
Aus Thomas Murner: Von dem großen lutherischen Narren, Straßburg 1522
Der Bauernkrieg im Kontext
„Der“ Bauernkrieg ist als zentraler Erinnerungsort in die deutsche Geschichte eingegangen. De facto gehört er freilich „in eine lange Reihe von europäischen und innerreichischen Aufständen und Widerstandsaktionen, die sich vom Spätmittelalter bis weit in die Neuzeit zieht“. (6) In Württemberg etwa lag der Aufstand des Armen Konrads gerade einmal 10 Jahre zurück; und die kleinen und mindermächtigen Grafen und Herren im Hohenlohischen und Rechbergischen bangten ebenso wie die Äbte Oberschwabens noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vor einem neuerlichen Aufstand des gemeinen Mannes, der die Hauptlast ständig höheren Türkensteuern zu tragen hatte. Die Bauern waren und blieben eine stete Bedrohung vor allem für die Herrschaftsträger von Adel und Kirche. Diesbezüglich war der Bauernkrieg alles andere als singulär.
-
Bauern plündern das Kloster Weißenau. Zeichnung aus der zeitgenössischen Chronik des Abtes Jakob Murer, 1525
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 523, Bd. 58, Bl. 4.
Der Bauernkrieg 1525
Singulär wurde der Bauernkrieg, der auf zahlreichen Schauplätzen – im Oberrheingebiet, in Württemberg und Oberschwaben, in Franken, Thüringen, Rheinland, Tirol und im Salzburgischen – ausgefochten wurde, weil die Aufständischen ihre Forderungen nicht nur auf religiöse Fragen ausweiteten, sondern zunehmend auch als aus dem göttlichen Recht des Evangeliums fließend begründeten. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die wohl wichtigste programmatische Schrift des Bauernkrieges, die dem Memminger Kürschnergesellen Sebastian Lotzer zugeschriebenen „Zwölf Artikel“.
Militärisch hatten die Aufständischen unbeschadet zahlreicher Teilerfolge gegen die sich über Religions- und Standesgrenzen solidarisierenden Fürsten und Landfriedenseinungen wie den Schwäbische Bund keine Chance. Der Bauernkrieg endeten in einer Serie blutiger Gemetzel – am 12. Mai endete die Erhebung in Württemberg in der Schlacht bei Böblingen, die 2.000 bis 3.000 Bauern das Leben kostete; in Thüringen endete der Aufstand mit der Schlacht von Frankenhausen (15. Mai), gefolgt von der Hinrichtung Thomas Müntzers; und am 17. Mai schließlich unterlagen die Aufständischen im Elsass bei Zabern Herzog Anton von Lothringen; mindestens 18.000 Erschlagene sollen das Feld bedeckt haben, vielfach aus Hass gegen die Lutheraner niedergemetzelt.
Bauernkrieg und Martin Luther
Für „die“ Reformation war der Bauernkrieg ungemein folgenreich, und dies aus mehreren Gründen: Keineswegs nur Thomas Müntzer, auch andere Prediger hatten sich im Bauernkrieg auf Seiten der Aufständischen engagiert. Dies brachte die Reformation nachhaltig in Misskredit, insbesondere bei den Obrigkeiten, die der neuen Lehre ohnehin skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden. Schweren Schaden nahm auch die Fama Luthers, der sich im Bauernkrieg mit mehreren Schriften zu Wort gemeldet hatte. Vor allem die verbalen Exzesse des Reformators hinterließen Eindruck bei Freund und Feind:
„Drumb, liebe herren, loset hie, rettet hie, helfft hie, Erbarmet durch der armen leute, Steche, schlahe, wuorge hier, wer da kann, bleybst druober tod, wol dyr, seliglichern tod kannstu nymer mer uberkomen, Denn du stirbst ynn gehorsam göttlichs worts und befehls R. am 13. Und ym dienst der liebe, deynen nehisten zuretten aus der hellen und teuffels banden“. (7)
Die verbalen Entgleisungen Luthers ließen frühere, wesentlich moderatere Äußerungen vergessen. Um seine harten Worte, die zurückzunehmen er auch später nicht bereit war, verstehen zu können, gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass Luther vor allem im Aufstand der Thüringer Bauern seinen alten Widersacher am Werk sah, Thomas Müntzer. Über ihn, dem „ertzteuffel, der zu Mölhusen regirt“, entdeckte er nun auch in den Bauern jene, „denen er zutraute, das Reich Gottes herbeizukämpfen“. (8) Getrieben von chiliastischen Hoffnungen, missachteten beide den grundlegenden Unterschied zwischen beiden Reichen, dem Reich Gottes und dem Reich der Welt. Sie vermischten weltliche Belange mit christlich-religiösen – und dies war in Luthers Perspektive ein fundamentaler Übergriff, den er nicht mitzutragen bereit war.
-
Titel der Schrift von Johannes Brenz: Von Milterung der Fürsten gegen den auffruersche Baure, 1525
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Theol. qt. K. 65.
Bauernkrieg und Johannes Brenz
Bereits die Zeitgenossen haben bei Luther die Barmherzigkeit vermisst. Dies gilt etwa für Johannes Brenz. In der Sache wusste er sich mit Luther durchaus einig: Denn wer die göttliche Herrschaft anerkenne, müsse auch der weltlichen Obrigkeit gehorsam sein, „nit wie der gemein Hauff schreyt, man wol kein Herrn mehr haben, Gott sey allein unser Herr“.(9) Der Aufruhr sei deshalb Gotteslästerung, unbeschadet dessen, dass alle, Obrigkeiten wie Untertanen, für ihn verantwortlich seien, weil sie alle die Gebote Gottes missachtet hätten. Als der Aufstand aber niedergeschlagen war, votierte Brenz für Milde gegenüber den Besiegten. Wie er in mehrfach – seiner Ermahnung an den Haller Rat vom Juni 1525 und seine Schrift Von Milterung der Fürsten gegenüber den auffrurischen Bauren – ausführte, solle nun Barmherzigkeit geübt und berechtigte Beschwerden abgestellt werden.
Bauernkrieg und Reformation
Der Wittenberger Reformator Martin Luther einerseits, der Reformator von Schwäbisch Hall Johannes Brenz andererseits sind Beispiele dafür, dass lutherische Theologen im Bauernkrieg durchaus unterschiedliche Positionen einnehmen konnten. Insgesamt gesehen freilich hat der Bauernkrieg der Reformation geschadet. Dafür einige Indizien: Auf den Reichstagen verschärfen sich die Gegensätze zwischen alt- und neugläubigen Reichsständen, weil die Exponenten des alten Glaubens die Schuld am Bauernkrieg der neuen Lehre zuschrieben. In der Flugschriftenliteratur ist nicht nur ein quantitativer Rückgang zu verzeichnen; es verschwinden auch fast völlig die Autoren aus dem Laienstand. Wortführer sind jetzt, fast ausschließlich, die Theologen. Und um Luther selbst wurde es, um Volker Leppin zu zitieren, „einsam“. (10) Sein Stern war im Sinken begriffen.
2.3: Außenseiter der Reformation
„Aneignungen“ reformatorischen Gedankengutes finden sich auch bei Außenseitern der Reformation, was „unseren“ Raum anbelangt insbesondere bei den Täufern und den Anhängern des schlesischen Adeligen Kaspar Schwenckfeld von Ossig. Rein zahlenmäßig allerdings fielen beide Strömungen kaum ins Gewicht: Bekannt sind für den Zeitraum zwischen 1525 und 1529 für ganz Schwaben 716 Täufer, für den Zeitraum 1530 bis 1549 822. Die Zahl der Schwenckfelder dürfte erheblich geringer gewesen sein, wobei in beiden Fällen – quellenbedingt – von erheblichen Dunkelziffern auszugehen ist.
Schwenckfelder
Die Anhänger Schwenckfelds, der sich 1525/26 mit Luther aufgrund seiner Betonung der Realpräsenz im Abendmahl überworfen hatte, hatten im Südwesten des Alten Reiches ihren regionalen Schwerpunkt, nicht zuletzt dank eines Netzwerks von Adeligen, die mit Schwenckfeld sympathisierten. Als wiedergeborene Heilige wussten sie sich auch von der sich entfaltenden lutherischen Kirche geschieden und einem eigenen Frömmigkeits- und Lebensstil verpflichtet.
Täufer
Namensgebend und konstitutiv für die Täufer wurde ihre Ablehnung der Kindertaufe. Gemeinsame theologische Überzeugungen in bestimmten Fragen sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Meinungsspektrum innerhalb der dissentierenden Strömungen erheblich variieren konnte. So trennten etwa den Kürschner Augustin Bader, der 1528 als einer der Vorsteher der Augsburger Gemeinde nachgewiesen ist, und Balthasar Hubmaier oder Michael Sattler Welten. Ersterer hielt seinen 1529 geborenen Sohn für den wiedergekommenen Messias und sich selbst für dessen Stellvertreter. Bei einem Ulmer Handwerker ließ er deswegen eigens königliche Insignien anfertigen. Für Anfang 1530 erwartete er den Anbruch des Tausendjährigen Reiches und das Gericht über die Gottlosen. Kurz darauf wurde er mit wenigen Anhängern in Lautern (bei Blaubeuren) gefangen genommen und am 30. März in Stuttgart mit seinem eigenen Königsschwert hingerichtet. Balthasar Hubmaier oder Michael Sattler hingegen entwickelten ausgehend vom Verständnis der Taufe als Zeugnis des inwendigen, aus dem Wort entstandenen Glaubens ausgefeilte, elitäre theologische Konzepte, die in die Artikel der Brüderlichen Vereinigung etzlicher Kinder Gottes vom 24. Febr. 1527 (Schleitheim) eingehen sollten. Beide starben für ihren Glauben: Balthasar Hubmaier wurde am 10. März 1528 wegen Aufruhrs in Wien verbrannt, seine Frau in der Donau ertränkt; Michael Sattler, der Meinungsführer der Horber Täufer, war bereits am am 21. Mai 1527 in Rottenburg verbrannt, seine Frau im Neckar ertränkt worden.
2.4: Eine späte Reformation: Die Reformation im Herzogtum Württemberg
-
Stadtansicht Mömpelgart (Montbéliard), Kupferstich 1644
Topographia Alsatiae, von Matthäus Merian, Wolfgang Hoffmann, Martin Zeiller, 1644.
Seit der Ächtung Herzog Ulrichs und seiner Vertreibung durch Truppen des Schwäbischen Bundes im Jahre 1519 stand das Herzogtum Württemberg unter habsburgischer Verwaltung. Seitdem stand allerdings auch die Frage nach einer möglichen Zurückgabe des Landes an das angestammte Herrscherhaus auf der politischen Agenda – sei es an Herzog Ulrich selbst oder seinen Sohn Christoph. Für die Restitution Herzog Ulrichs optierte vor allem Landgraf Philipp von Hessen, an dessen Hof sich der Württemberger seit 1526 aufhielt. In Philipps Kalkül spielten sowohl religionspolitische als auch machtpolitische Überlegungen eine zentrale Rolle, war dem Land doch eine „Brückenfunktion“ zu den oberdeutschen Reichsstädten zugedacht, die ihrerseits zu den wichtigsten Bundesgenossen des hessischen Landgrafen zählten. 1533/34 war der Moment gekommen – befördert durch den Umstand, dass sich die Habsburger mit einer Vielzahl weiterer Konflikte innerhalb des Reichsverbandes konfrontiert sahen, insbesondere dem konfessionsübergreifenden Widerstand gegen die Königswahl Ferdinands, des Bruders Karls V. Um die Position Ferdinands zu sichern, schien dem habsburgischen Familienverband ein regionaler Positionsverlust akzeptabel. Dies erklärt, warum der Württembergerzug des hessischen Landgrafen binnen kürzester Zeit zum Erfolg geführt werden konnte.
-
Herzog Ulrich von Württemberg in Rüstung mit Schwert samt Heerlager in der Schlacht bei Lauffen 1534
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 703 R128N4
Nachdem sich Philipp im Januar 1534 gegen die Verpfändung der württembergischen Grafschaft Mömpelgard der finanziellen Unterstützung des französischen Königs versichert hatte (Vertrag von Bar le Duc), brachen die von ihm und Herzog Ulrich geworbenen Truppen im April 1534 von Kassel auf. Wenig später, nach dem Gefecht bei Lauffen am 13. Mai 1534, war der Feldzug militärisch entschieden. Angesichts des Desinteresses der Habsburger an Württemberg stand damit nicht mehr das Dass einer Restitution Herzog Ulrichs, sondern lediglich das Wie seiner Restitution zur Verhandlung an. Vermittelt durch den sächsischen Kurfürsten, stimmte König Ferdinand im Vertrag von Kaaden (29. Jan. 1534) der Wiedereinsetzung Herzog Ulrichs zu, der sich seinerseits bereit erklärte, Württemberg als Lehen der Erzherzöge von Österreich zu empfangen (sog. Afterlehnschaft). Lediglich das Recht, seine Lande reformieren zu dürfen, hatte der Württemberger in späteren Sonderverhandlungen noch durchsetzen und damit die eigene Position zumindest auf dem Felde der Religionshoheit entscheidend verbessern können.
3: Die politische Konsolidierung der Reformation
Bis zum Augsburger Religionsfrieden des Jahres 1555 waren die Fürsten und Städte, die sich vor Kaiser und Reich zur Reformation bekannten, mehr oder minder akut bedroht – vom Papsttum, einer altgläubigen Mehrheit unter den Reichsständen und einem Kaiser, der an seiner Katholizität keinen Zweifel aufkommen ließ. 1530/31 schlossen sich daher unter der Führung des sächsischen Kurfürsten und hessischen Landgrafen ein Teil der evangelischen Fürsten und Städte im Militärbündnis des Schmalkaldischen Bundes zusammen, wobei es ihnen vornehmlich darum zu tun war, zu verhindern, dass gegen das Wortes Gottes „mit gewalt und der tat“ vorgegangen würde.
„Der Schmalkaldische Bund bot den entscheidenden Rückhalt zur Ausbreitung und Sicherung des evangelischen Glaubens“. (11) Dies gilt insbesondere für die kaiserlose Zeit der 1530er Jahre. Allerdings erwies sich der bündische Zusammenhalt als fragil. Von den wachsenden Spannungen innerhalb des Bündnisses, bedingt durch divergierende Interessenlagen der beiden Hauptleute bzw. der fürstlichen und städtischen Bundesmitglieder, profitierte insbesondere der Kaiser. Nachdem Karl V. in den frühen 1540er Jahren letztmals zwischen den sich konsolidierenden konfessionellen Lagern zu vermitteln versucht hatte, suchte er die militärische Konfrontation. Um den Anschein eines Religionskrieges zu vermeiden, ließ er 1546 die Acht über Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen verhängen.
Dies war der Auftakt zum Schmalkaldischen Krieg 1546/47, der einen übermächtig gewordenen Kaiser als Sieger sah. Insbesondere für die Protestanten war die religionspolitische Situation bedrohlich: Im Zenit seiner Macht stehend, oktroyierte Karl V. auf dem geharnischten Reichstag in Augsburg (1. Sept. 1547 – 30. Juni 1548) den Protestanten ein nur sie betreffendes „Ausnahmegesetz“ (Bizer) mit wenigen Konzessionen (Laienkelch und Priesterehe) – der römisch-kaiserlichen Majestät Erklärung, wie es der Religion halben im Heiligen Reich bis zum Austrag des gemeinen Concilii gehalten werden soll vom 15. Mai 1548, das Interim. Im Südwesten des Alten Reiches gerieten vor allem die Reichsstädte, aber auch größere Territorien wie das Herzogtum Württemberg in massive Bedrängnis.
Die Anwendung des Interims „war eine Machtfrage“ (Reinhardt). Vor allem in den süddeutschen Reichsstädten sollte sie tiefe Spuren hinterlassen: Verfassungsrechtlich, weil Karl V. die bisherige Beteiligung der Zünfte an der städtischen Regierung zugunsten patrizisch-oligarchischer Herrschaftsstrukturen beendete; kirchlich, weil mit dem erzwungenen Exodus zahlreicher Geistlicher die städtische Reformation in eine tiefe Krise geriet, die das Ende der oberdeutschen Reformation bedeutete. Das Luthertum entwickelte sich nun auch hier zur allein gestaltenden Kraft. in einem Fall, Konstanz wurde sogar die Rückkehr zum alten Glauben erzwungen.
Im Schmalkaldischen Krieg hatte Karl V. triumphiert, zugleich aber seine Macht überdehnt. Der Erfolg des Kaisers evozierte im Reich den Widerstand der Fürsten, der „wirklich Mächtigen“, die konfessionsübergreifend darauf hinwirken, die drohende kaiserliche „Monarchia“ abzuwehren und das „spanische Servitut“ zu beenden. Zugleich brachen eine Vielzahl neuer (habsburgischer Bruderzwist) wie alter Konflikte auf (Auseinandersetzungen mit Frankreich und dem Papsttum). Der Fürstenaufstand (März 1552), der maßgeblich durch Moritz von Sachsen evoziert war, leitete den Niedergang der Macht Karls V. ein. Noch bevor er am 12. September 1556 den Kurfürsten förmlich seine Abdankungsurkunde überantwortete, hatte er die Geschicke des Reiches seinem Bruder Ferdinand überantwortet. Auf dem Reichstag von Augsburg (5. Febr. bis 25. Sept. 1555) wurden die Vereinbarungen getroffen, die für die nächsten Jahrzehnte die Geschicke des Reichs bestimmen sollten. Die Wiedervereinigung in der Religion wurde als Verfassungsgebot zwar beibehalten. Für die Zwischenzeit aber wurde eine interimistische Ordnung etabliert, basierend auf weltlich-politischem Frieden und rechtlich garantierter Koexistenz zwischen beiden anerkannten Konfessionen, den Katholiken und den Augsburger Konfessionsverwandten.
Der Augsburger Religionsfriede war eine Notordnung, die im Reich das friedliche Nebeneinander der Konfessionen rechtlich garantierte und im Territorium das entgegensetzte System konfessioneller Einheitlichkeit und Absolutheit etablierte. Konfliktträchtige Unklarheiten waren in ihm absichtlich eingebaut, sie waren einer mehrdeutig-verschleiernden, „dissimulierenden“ Rechtssprache eingeschrieben. Pazifizierende Wirkung war ihm nur so lange eigen, als die vertragsschließenden Parteien sich entsprechend verhielten. Eben dies machte die Brüchigkeit des Friedens aus. Für die Protestanten war er gleichwohl ein enormer Erfolg, sicherte er doch „die“ Reformation politisch ab und bot mit Blick auf die weltlichen Obrigkeiten die Chance auf Zuwachs.
4: Institutionalisierung der Reformation – das Beispiel Württemberg
4.1: Oberdeutsche oder lutherische Reformation?
-
Der Reformator Erhardt Schnepf, Kupferstich 16. Jahrhundert
Persönlichkeiten und Interessen(gruppen)
Die Reformation in Württemberg war eine Fürstenreformation: Konkret heißt das, dass der Landesherr nach der siegreichen Schlacht bei Lauffen – eigentlich eher ein harmloses Gefecht – kraft landesherrlicher Machtvollkommenheit entschied, welcher Glaube, der alte oder der neue, zukünftig in seinem Herrschaftsbereich als alleingültig anzusehen und zu respektieren sei. Seinen Untertanen stand somit nicht das Recht zu, über ihren Glauben selbst entscheiden zu können. Er wurde ihnen im wahrsten Sinne des Wortes von oben auferlegt.
Um die Reformation seines Landes nicht nur zu dekretieren, sondern auch praktisch umsetzen zu können, stützte sich der württembergische Landesherr auf eine eher kleine Zahl an Experten – Juristen und weltliche Räte, vor allem aber (naturgemäß) Theologen. Manche von ihnen, wie etwa der aus Schwäbisch Hall stammende Johannes Brenz, wurden in der Anfangsphase der württembergischen Reformation eher punktuell einbezogen, Brenz vor allem dann, wenn theologischer Rat gefragt bzw. theologische Differenzen auszuräumen waren oder wenn es galt, die nötigen kirchlichen Ordnungen auszuarbeiten. Anderen wie Erhard Schnepf und Ambrosius Blarer war eine Schlüsselfunktion bei der Einführung der Reformation zugedacht: Ihnen oblag es, „die Reformation“ in einer Vielzahl einzelner Aktivitäten konkret einzuführen.
Konkurrierende Strömungen: Luthertum und oberdeutsche Reformation
Indem er sowohl den dezidierten Lutheraner Erhard Schnepf als auch den überzeugten Anhänger der oberdeutschen Reformation, Ambrosius Blarer, mit der Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg beauftragte, hatte der württembergische Herzog eine Grundsatzentscheidung getroffen – die Entscheidung nämlich, konkurrierende theologische Strömungen in seinem Lande zuzulassen. Was Herzog Ulrich letztendlich bewog, diese „Konzeption eines Zusammenwirkens von Lutheranern und Oberdeutschen“ (12) zu favorisieren, ist schwierig bis unmöglich zu entscheiden. In jedem Fall war die herzogliche Entscheidung risikobehaftet – vor allem aufgrund der Differenzen im Abendmahlsverstädnis. In dieser Frage hatten sich bereits Luther und Zwingli im Marburger Religionsgespräch des Jahres 1529 nicht zu verständigen gewusst, was allen Beteiligten fraglos wohl bewusst war.
Die zentrale Herausforderung: die Abendmahlsfrage
Bereits im ersten Zusammentreffen des Herzogs mit „seinen“ beiden Reformatoren schnitt Schnepf die Problematik an, indem er die Verständigung in der Abendmalsfrage als Voraussetzung für ein ersprießliches Zusammenwirken benannte: Blarer möge zugestehen, dass im Abendmahl Leib und Blut Christi sowohl den Frommen als auch den Gottlosen gereicht werde, eine Forderung, die auf darauf zielte, die reale Präsenz von Leib und Blut Christi unabhängig vom Empfänger sicherzustellen. Blarer hingegen hatte, wie die oberdeutsche Richtung der Reformation generell, bislang immer auf einer geistlichen Speisung allein der Gläubigen beharrt. In der sog. Stuttgarter Konkordie von 1534 gelang es, nicht zuletzt dank der Kontakte von Blarer zum Straßburger Reformator Martin Bucer, sich auf eine gemeinsame Formel zu verständigen: „Wir bekennen, dass aus vermög dieser Wort „Das ist mein Leib, das ist mein Blut“ der Leib und das Blut wahrhaftiglich (hoc est substantive et essentialiter, non autem quantitative vel qualitative vel localiter) im Nachtmahl gegenwärtig sei und gegeben werd“. (13)
Der gefundene, auf das Marburger Religionsgespräch zurückgehende, dort aber von der oberdeutschen Seite abgelehnte Kompromiss erwies sich jedoch als nicht tragfähig. Vor allem Blarer geriet unter Druck und distanzierte sich in der Folgezeit von den seinerzeit gemachten Zugeständnissen. Im Mai 1538 kam es zum definitiven Bruch: In Formen, die Blarer als entwürdigend empfinden musste, entließ Herzog Ulrich den in Ungnade gefallenen Theologen. Dies war weit mehr als nur ein persönliches Scheitern; dies implizierte die Niederlage der oberdeutschen Richtung der Reformation im Herzogtum Württemberg.
4.2: Die „Einführung“ der Reformation in Württemberg: Kein Ereignis – ein Prozess
-
Johannes Brenz (1499-1570), Ausschnitt aus dem Epitaph von Jonathan Sauter in der Stuttgarter Stiftskirche, 1584
Die Neuordnung des Kirchenwesens war nicht binnen weniger Jahre zu bewerkstelligen. Sie erstreckte sich faktisch über mehr das drei Jahrzehnte und reichte infolgedessen weit in die Regierungszeit Herzog Christophs hinein. Wie insbesondere an der Vielzahl der obrigkeitlichen Ordnungen ablesbar ist, die zwischen 1534 und 1559 (und später) erlassen wurden, baute der Sohn vielfach auf dem Wirken seines in der württembergischen Geschichtsschreibung äußerst negativ bewerteten Vaters auf. So fraglos Herzog Ulrich und Herzog Christoph sich in ihren persönlichen Dispositionen unterschieden, so verschieden ihr Regierungsstil war, so offenkundig sind die Kontinuitäten im Regierungshandeln und insbesondere in der territorialen Religionspolitik beider Fürsten. Maßgeblich begünstigt wurde dies durch wichtige Personen im Umfeld der Herzöge: Johannes Brenz, bereits unter Herzog Ulrich vielfach mit württembergischen Kirchenfragen befasst, avancierte unter seinem Sohn zur unumstrittenen Leitfigur der württembergischen Kirche, ein kongenialer „Partner“ und hochkompetenter Berater seines Landesherren (1515-1568, regierend seit Nov. 1550); aber auch weltliche Räte spielten eine herausragende Rolle, z.B. Erbmarschall Hans Konrad Thumb von Neuburg oder Balthasar von Güglingen.
4.3: Neubesetzung der Pfarrstellen
Die Differenzen zwischen Schnepf und Blarer hatten auch die Aufgabe überschattet, die nach der Restitution Ulrichs an erster Stelle auf der religionspolitischen Agenda gestanden hatte: die Neubesetzung der Pfarrstellen. Zwar war versucht worden, beiden Reformatoren jeweils eigene Zuständigkeitsbereiche entlang einer alten Trennungslinie zuzuweisen: Erhard Schnepf, dem Lutheraner, wurde das Land unter der Steig einschließlich der Residenzstatt überantwortet, Ambrosius Blarer, dem Oberdeutschen, der Landesteil ob der Steig. Gleichwohl erschwerten die Versuche beider, eigene Anhänger möglichst nicht nur im eigenen Zuständigkeitsbereich zu platzieren, die eigentliche Aufgabe zusätzlich. Und diese war ohnehin schwierig genug zu lösen: die bisherigen Stelleninhaber waren vielfach nicht für die Reformation zu gewinnen bzw. wenig geeignet; evangelische Pfarrer waren nicht ausreichend verfügbar, und die weltlichen Beamten konnten die Reformation ebenso befördern wie behindern. Zudem standen rechtliche Hindernisse einer Reformation vor Ort vielfach im Wege. Es kann daher nicht überraschen, wenn der Prozess der Reformation mit der erforderlichen Klärung der Konfessionsgrenzen stellenweise das gesamte 16. Jahrhundert andauerte.
4.4: Neue Ordnungen für eine neue Kirche
-
Abendmahlskanne aus dem Ulmer Münster vom Ulmer Goldschmied und Zunftmeister Hans Miller, um 1530
Fotograf: Dieter Peters
Die Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg gründete nicht in einem theologischen Konzept, das dann umgesetzt worden wäre. Sie erfolgte vielmehr tastend, zögernd, nachjustierend, dem Beispiel anderer Fürsten folgend. Vor allem aber war sie praxisgeleitet, d.h. auf konkrete Herausforderungen musste – teils rasch – eine möglichst zweckmäßige „Lösung“ gefunden werden. Dies freilich unter erschwerten Bedingungen: Denn die verfügbaren personellen Ressourcen war ebenso knapp wie die finanziellen, und die reichspolitischen Rahmenbedingungen waren bis zum Augsburger Religionsfrieden (1555) prekär.
Gottesdienst
Vordringlich war vor allem die Neuregelung des Gottesdienstes. „Erstlich wollte jedermann nur eine titsche deutsche Meß hun, darnach hat man an etlichen Orten ganz davon glun“ (14). Diese Aussage des Biberacher Patriziers Heinrichs VI. von Flummern gilt nicht nur für die oberdeutschen Reichsstädte, wo bis 1531 sämtliche Stiftungs- und Pfarrmessen abgeschafft und durch den reformatorischen Predigtgottesdienst ersetzt wurden; sie gilt auch für das Herzogtum Württemberg, wenngleich – bedingt durch die württembergische Reformationsgeschichte – mit zeitlichem Verzug. Die erste evangelische „Kirchenordnung“ des Landes (1535) war faktisch eine Ordnung für den Gottesdienst. Dabei entschieden sich die Reformatoren des Herzogtums Württemberg dazu, den spätmittelalterlich-reichsstädtischen Prädikantengottesdienst zu übernehmen und zum sonn- und werktäglichen Hauptgottesdienst zu erheben. Denn diese (liturgische) Formgebung, die den Ablauf unseres Sonntagsgottesdienstes bis heute prägt, galt den südwestdeutschen Reformatoren, die vielfach zuvor auf Prädikantenstellen gewirkt hatten, als schriftgemäß (Kol 3,18: „Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt einander in der Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen“) und apostolisch („Dann aus der Vätter schryfft vnnd hystorien genuegsam bewust, das die allten in sollcher christlicher kürchen Ybung ettlich wenig Psallmen mit höchster andacht gesungen haben vnd daraufff ain capitel aus der schryfft verlesen vnnd ausgelegt vnnd demnach in gemain gebettet“). (15)
Katechismus
In der Kirchenordnung von 1535 war auch erstmals die Forderung nach einem „gleichförmigen, beständigen, kurzem und kleinem Katechismus“ förmlich erhoben worden. Die bereits vorliegenden Katechismen Luthers, der große sowie der kleine Katechismus (beide 1529), sollten allerdings nicht zu Zuge kommen. Dem stand, so steht zu vermuten, die zwischen lutherischer und oberdeutscher Reformation oszillierende Haltung des Landes entgegen. Stattdessen wurde dem 1535 von Johannes Brenz für Schwäbisch Hall verfassten Katechismus der Vorzug gegeben, den „Fragstück des Christlichen glaubens für die Jugendt“ – ein im Erstdruck gerade 10 kleine Oktavseiten umfassendes Meisterwerk. In Frage und Antwort-Schema verfasst, trug es den pädagogischen Überzeugungen seines Verfassers Rechnung, der davon warnte, den Kindern zuviel zuzumuten: „So ist es auch nit fruchtbarlich, daß man sie die Kinder mit viel Letzen d.h. Lektionen, Schulaufgaben uberschutt, gleich wie es geschicht, so man ein Trichterlein in einer Flaschen steckend uberschutt, so rinnt es doch neben ab. Also auch mit den Jungen geschicht´s, so man sie überlädt, daß sie keines recht lernen“. (16)
Der Brenzsche Katechismus war ein großer Wurf. Er erlebte Hunderte von Auflagen, wurde auch ins Lateinische übersetzt (um in den höheren Schulen genutzt werden zu können). In Württemberg wurde er bis in die Gegenwart in der evangelischen Unterweisung genutzt. Im süddeutschen regionalen Umfeld war er zeitweilig oder längerfristig in zahlreichen Städten oder Fürstentümern im Gebrauch oder beeinflusste zumindest die dortigen Katechismen. Selbst in den afrikanischen und asiatischen Missionsgebieten des 19. Jahrhunderts ist er nachzuweisen.
Neuordnung der Ehe
In der alten Kirche waren geistliche Gerichte für das Eherecht (und alle sich daraus ergebenden Fragen) zuständig gewesen. Dies änderte sich mit der neuen Bewertung der Ehe durch die Reformatoren: Für Luther gehörte die Ehe in den Bereich der göttlichen Schöpfungsordnung, und auch nach dem Fall überragte der Ehestand alle anderen Stände an Würde: Er ist „der gemeineste, edleste Stand, so durch den ganzen Christenstand, ja durch alle Welt gehet und reichet“. (17) Aus der neuen theologischen Bewertung der Ehe ergab sich folgerichtig und zwingend die Notwendigkeit, auch das Eherecht neu zu fassen. Eine erste grundsätzliche Regelung erfolgte in der Eheordnung vom 1535/36, der ersten im Druck vorliegenden Eheordnung des Protestantismus überhaupt. 1553, unter Herzog Christoph erfolgte eine Überarbeitung, die aber die zentralen Bestimmungen nicht tangierte. Bereits zuvor, nachweislich seit 1541, war ein Ehegericht mit Sitz in Stuttgart eingerichtet worden sein. Besetzt war es mit zwei Theologen, zwei Juristen und drei weiteren Räten.
Das Übergewicht weltlicher Räte im Stuttgarter Ehegericht könnte als Indiz dafür zu werten sein, was die herzogliche Regierung nicht wollte – einen als zu weit reichend empfundenen Einfluss der Theologen. Ihnen scheint ein zu weitgehender moralischer Rigorismus unterstellt worden zu sein. Bezeichnenderweise war Blarer, der in Konstanz maßgeblich für die Kirchen- und Sittenzucht verantwortlich zeichnete, von Anfang an übergangen, sprich nicht mit der Materie befasst wurden (bezeichnenderweise äußerte er Januar 1535 die Klage, die Sittenzucht in Württemberg werde ausweislich eines von Schnepf stammenden Entwurfs einer Eheordnung zu lax gehandhabt). Und selbst den an sich schon gemäßigten Entwurf (vom Sommer 1535) eines Johannes Brenz für die Eheordnung ließ der Herzog noch einmal mildern. Für die Bewertung der Sittenzucht in Württemberg ist dieser Befund nicht ohne Relevanz. Die Handhabung im Land unterschied sich signifikant von jener in den oberdeutschen Reichsstädten.
Obrigkeitliche Sittenzucht
Die Sittenzucht war in der frühen Neuzeit ein Feld, auf dem Kirche und Staat gemeinsam agierten. Bereits in vorreformatorischer Zeit hatten sich die Fürsten, auch die Herzöge von Württemberg, des Seelenheils ihrer Untertanen angenommen und daher auch Ordnungen erlassen, die das kirchliche Leben betrafen. Insofern stehen die ausführlichen Bestimmungen der Landesordnung vom 1. Juni 1536 in einer ins späte Mittelalter zurückreichenden Tradition. „Neu“ ist vor allem dreierlei:
-
die Bestimmungen orientierten sich nun an der neuen Lehre, so etwa bereits in der ersten Schutzbestimmung der Ordnung: Sie galt dem Wort Gottes als der lebendigmachenden Speise der Seelen und Wegweiserin in das himmlische Vaterland und hat kein Äquivalent in früheren Ordnungen;
-
die noch stärkere Betonung der Rolle der Obrigkeit, der die Sorge für die Aufrechterhaltung christlicher Sitte obliegt, und die eher dienende Rolle der Kirche. In diesem Zusammenhang kommt der Herzog mehrfach auf „seine“ Kirchendiener zu sprechen;
-
der Umfang der gebotenen bzw. verbotenen Materien, deren materielles Substrat weithin konfessionsübergreifend als regulierungsbedürftig eingestuft wurde. Hier unterscheiden sich Protestantismus und Katholizismus nur graduell, nicht prinzipiell.
Sonstiges
Reformatorische und/ oder im landesherrlichen Machtwillen gründende Neuerungen sind keineswegs nur in den genannten Bereichen zu verzeichnen. Zu verweisen wäre insbesondere noch auf die Bilderfrage, in der sich der Protestantismus insgesamt vom Katholizismus abgrenzte, in der aber auch erbitterte binnenkonfessionelle Auseinandersetzungen ausgetragen wurden.
4.5: Landesherr und Kirchengut
-
Klosteranlage Blaubeuren, kolorierte Zeichnung von Gabriel Bucelin, 1630
Württembergische Landesbibliothek
Grundsätzliches
Die Verfügung über das (mittelbare) Kirchengut war bereits früh zwischen evangelischen Theologen und ihrer Obrigkeit umstritten. Durchsetzen sollten sich schließlich letztere: Sie erreichten, dass neben den von den Theologen benannten Verwendungszwecken – Ministeria ecclesiae, Schule, Arme – der Obrigkeit das Recht zugesprochen wurde, „zuverordnen, und mit solchen gütern und was doran … ubrig sein mochten also zuhandeln, zu geparen und umbzugehen …, wie das jegen gott, aller erbarkeit und meniglichen unpartheisch getrauen zuverantworten und ain christliche obrigkait schuldig und unvorweißlich ist“ (Tag zu Schmalkalden, 1541). (18) Damit hatten sich die evangelischen Obrigkeiten die Möglichkeit eröffnet, über alle Mittel, die nicht für die vorrangige Zwecksetzung benötigt wurden, nach eigenem Gutdünken verfügen zu können. Und von dieser Möglichkeit haben alle protestantischen Obrigkeiten in mehr oder minder großem Umfang auch Gebrauch gemacht. Das war Reformation auch: eine Mediatisierung von Kirchengüter in großem Stil.
Die Klöster
Besonders evident war dies in der Klosterfrage. Denn mit der neuen Lehre waren die Klöster, die sich zudem vielfach als Bastionen des alten Glaubens erwiesen, theologisch obsolet: die Werkfrömmigkeit der Mönche bzw. Nonnen und das sola gratia der Reformatoren waren schlechterdings unvereinbar. Zudem verfügten keineswegs alle, aber zahlreiche Klöster über ein enormes Vermögen und großen Landbesitz: In Württemberg etwa besaßen allein die 14 bzw. 15 großen Mannsklöster, deren Prälaten auch im Landtag vertreten waren, über ein Drittel der Landesfläche. Und sie waren nur ein Teil, freilich der bedeutendste Teil, einer vielfältigen Klosterlandschaft.
Religiöse, wirtschaftliche und politische Motive, letztendlich unentwirrbar miteinander vermengt, sind somit in der Klosterpolitik Herzog Ulrichs auszumachen. Bereits im November 1534 ließ Ulrich das gesamte Vermögen der Klöster inventarisieren und der landesherrlichen Verfügungsgewalt unterstellen; ab Mitte der 1530er Jahre wurde der Klosterbesitz sukzessive von der herzoglichen Administration übernommen. Zugleich wurde es den Klöstern verboten, neue Bewerber aufzunehmen – sie sollten aussterben. Wenig später, Folge einer Besprechung zwischen dem ehemaligen Dominikanermönch Ambrosius Blarer und dem württembergischen Herzog Ulrich auf dem Einsiedel bei Tübingen (13. Dez. 1534) setzen die Bestrebungen ein, durch qualifizierte Lektoren die Klosterinsassen für die neue Lehre zu gewinnen – mit höchst unterschiedlichem, insgesamt eher unbefriedigendem Erfolg. Vor allem die Frauenklöster widersetzten sich jeglicher Belehrung – insofern hat der altkirchliche Widerstand gegen die Einführung der Reformation einen gender Aspekt.
Pfarrstellen und Gemeiner Kasten
Dass Geistliche und damit auch Pfarrstellen gerade auch im nunmehr evangelisch gewordenen Württemberg von grundlegender Bedeutung – und damit auch zu finanzieren – waren, stand außer Frage. Zu klären waren der nötige Umfang und die Modalitäten der Finanzierung. In dieser sensiblen und dringlichen Frage unterblieb zunächst eine generelle Regelung. Stattdessen wurden in Ämtern, Städten und Dörfern Einzelfallentscheidungen getroffen, vielfach in Verbindung mit den Visitationen – mit der Tendenz, die Zahl der Pfarrstellen so gering wie möglich zu halten und die Besoldung der Pfarrer zwar dauerhaft sicherzustellen, aber eher spärlich zu bemessen (was vielfach Klagen über schlechte Versorgung evozierte und zu gelegentlichen Besoldungsaufbesserungen oder anderen Unterstützungsleistungen führte). Zugleich wurde mit der Kastenordnung vom März 1536 verbindlich festgelegt, wie sich das örtliche Kirchenvermögen zukünftig zusammensetzen solle. Von ihm waren von nun an die örtlichen Kirchenbau-, Schul- und Besoldungsaufwendungen zu tätigen und die Armen zu unterstützen.
Der Gemeine Kasten
Die Mittel der aufgehobenen Pfarrstellen, insgesamt ca. 600 bis 700, zog der Herzog ein und schlug sie zu seinem Kammervermögen, ebenso die kirchlichen Vermögenswerte, die nicht dem örtlichen Kirchenvermögen zugeschlagen wurden. Erst unter seinem Sohn und Nachfolger, Herzog Christoph, erfolgte eine grundsätzlich andere Richtungsentscheidung. Mit der Einrichtung eines Gemeinen Kirchenkasten im Jahre 1552 wurde eine geistlichen Finanzverwaltung aufgebaut, die von der weltlichen Verwaltung vollständig abgetrennt war. Allerdings verblieben die Vermögensmassen und Einkünfte aufgehobener kirchlicher Einrichtungen, die bereits zur Zeit Herzog Ulrichs zur Kammer gezogen worden waren, dort; zudem wurde das Vermögen der großen Mannsklöster getrennt verwaltet. Gleichwohl war mit dem Gemeinen Kirchenkasten eine kirchliche Zentralkasse verfügbar, die für gesamtkirchliche Belange aufkam und von dem Willen geleitet war, „der Kirche das Ihre zukommen zu lassen“. (19)
4.6: Kirchenleitung
-
Schaubild: Die Leitung der württembergischen Kirche
Aus: Hermann Ehmer, Stiftsprobst in Stuttgart, in: Johannes Brenz 1499-1570, Hrsg. Hällisch-Fränkisches-Museum, 1999
Eine Kirchenleitung im Vollsinn des Wortes hat sich im Herzogtum Württemberg, wie in anderen Territorien auch, erst relativ spät und in einem komplizierten Prozess herausgebildet. Die Verwaltungsstrukturen, auf die sich das Kirchenregiment des Landesherrn stützen konnte, haben sich sehr allmählich ausgeformt und erst unter Herzog Ulrichs Nachfolger, Herzog Christoph von Württemberg, ihre dann allerdings für Jahrhunderte kaum noch veränderte Gestalt angenommen. Maßgeblichen Anteil daran hatte Johannes Brenz.
Am Anfang der höchst komplexen und nicht immer im Detail nachvollziehbaren Entwicklung standen einzelne Visitationskommissionen aus Theologen (allen voran Ambrosius Blarer und Erhard Schnepf) und weltlichen Räten. Letzteren oblagen vorrangig alle Finanzfragen; erstere waren vor allem für Personalfragen zuständig, insbesondere die Prüfung der anzustellenden Geistlichen. Erste Bestrebungen zur Organisation einer mittleren kirchlichen Verwaltungsebene sind in den 1540er Jahren zu verzeichnen; 1551 wurden dann mit der Einrichtung der Ämter der Spezialsuperintendenten dauerhafte Strukturen geschaffen; bereits zu diesem Zeitpunkt findet sich die Einteilung des Landes in vier Sprengel, in denen ein Generalsuperintendent als Vorgesetzter der Speziale amtierte. Zwischen 1553 und 1559 wurde dann eine kirchenleitende Behörde eingerichtet – neben Rentamt (Finanzverwaltung) und Oberrat (allgemeine Verwaltung, Recht). Der so geschaffene Kirchenrat, für den sich die Bezeichnung Konsistorium einbürgerte, war in eine weltliche und geistliche Bank unter dem Vorsitz von Landhofmeister bzw. dem Propst zu Stuttgart gegliedert. Während den Räten der weltlichen Bank wirtschaftliche und rechtliche Angelegenheiten oblagen, befassten sich die geistlichen Räte vornehmlich mit Personalangelegenheiten.
Zentrales Mittel der Kirchenleitung war die Visitation, für die ein jährlicher Turnus gebräuchlich wurde. Die Berichte der Spezialsuperintendenten, denen die Visitation von Ort oblag, gingen über die Generalsuperintendenten in gekürzter Form an den Kirchenrat und wurden hier in einer gemeinsamen Sitzung, dem Synodus, unter Vorsitz des Stuttgarter Propstes beraten. Der Synodus fasste die notwendigen Beschlüsse, die dann dem Herzog zur abschließenden Genehmigung vorgelegt wurden.
4.7: Die Rechte der Gemeinden
Kirchenorganisation und Kirchenleitung eignete eine stark zentralistische Tendenz. Den Gemeinden blieb, anders als in den frühen Vorstellungen führender Reformatoren, nur ein geringer Handlungsspielraum. Ein Recht, bei der Wahl ihrer Pfarrer mitzuwirken, kam ihnen nicht zu, ebenso wenig waren presbyteriale Gremien vorgesehen. Die meisten Befugnisse hatte die Gemeinde, die nicht in kirchlich und bürgerlich geschieden war, in weltlichen Belangen, z.B. auf dem Gebiet des kommunalen Armenwesens.
4.8: Eine neue Funktion: Klöster als Schulen
-
Die württembergischen Seminare und Klosterschulen, kolorierter Kupferstich, 19. Jahrhundert
Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 91.109
Mediatisierung und Reformation der Klöster hatten im Fokus der Klosterpolitik von Herzog Ulrich gestanden. Sie sollten auch die Politik seiner Nachfolger teils noch für Jahrzehnte bestimmen. Nach dem Rückschlag des Interims, in dem sich namentlich die großen Mannsklöster unter dem Schutz des siegreichen Kaisers dem Lande gänzlich zu entziehen drohten, waren die politischen Rahmenbedingungen dank Passauer Vertrag (1552) und Augsburger Religionsfrieden (1555) für die württembergischen Herzöge allerdings vorteilhafter. Denn nun war die Mediatisierung landsässiger Klöster reichsrechtlich möglich. In Württemberg erfolgte sie in zunächst relativ behutsamen Formen, beginnend 1552 in Murrhardt, wo der neunzehnjährige Sohn des Klostervogtes als neuer Abt installiert wurde, endend in den Verhaftungen der Äbte von Blaubeuren (Christian Tubingius) und Alpirsbach (Jakob Hochreuter) im Jahre 1562. Die Reformation der großen Mannsklöster im Lande, der wichtigsten Klöster, war damit abgeschlossen; andere, minder bedeutsamen Klöster, vor allem Frauenklöster, existierten als Residualpositionen des alten Glaubens teils noch über einen langen Zeitraum. Größere Misserfolge verzeichnete die herzogliche Regierung in St. Georgen, dessen Konvent sich gespalten hatte (der katholische Abt und sein Kapitel residierten in Villingen unter dem Schutz der Habsburger), und in Zweifalten, das zwar die württembergische Schutzherrschaft anzuerkennen hatte, aber beim alten Glauben verblieb.
Einen neuen Akzent in der Klosterpolitik setzte Herzog Christoph mit der von Brenz verfassten Klosterordnung vom Januar 1556. Ihr Kerngedanke war, die Klöster als Ausbildungsstätten für den geistlichen Nachwuchs zu betrachten und damit ihrer – angeblichen – ursprünglichen Zweckbestimmung als Schulen wieder zuzuführen. Unter dieser Prämisse konnte auch von der seitherigen klösterlichen Übung so viel beibehalten werden, als schriftgemäß war oder vernünftig erschien.
Wenngleich die Anfänge bescheiden waren – als Brenz 1556 die Klosterschulen visitierte, fand er etwa in Maulbronn nur sieben Schüler vor –, so waren sie doch zukunftsweisend. Bereits der Landtagsabschied von 1565 ging davon aus, dass in den vorgesehenen 13 Klöstern insgesamt 200 Schüler unterhalten werden sollten. Ihr Unterrichtsprogramm wurde in der großen Kirchenordnung von 1559 noch einmal modifiziert; zudem wurde nun zwischen höheren und niederen Klosterschulen unterschieden. Als höhere Klosterschulen waren Bebenhausen, Alpirsbach, Hirsau und Herrenalb vorgesehen; niedere Klosterschulen waren Adelberg, Alpirsbach, Anhausen, Blaubeuren, Denkendorf, St. Georgen, Königsbronn, Lorch und Murrhardt. Diese Vielfalt konnte allerdings vornehmlich aus finanziellen Gründen nicht dauerhaft durchgehalten werden. Bis 1700 verringerte sich die Zahl auf vier Klosterschulen. Ihr gemeinsames Merkmal war die eindeutige Orientierung auf den geistlichen Beruf.
4.9: Schulwesen, Universität, Stift
-
Aufforderung Luthers an die Ratsherren aller Orten, Schulen für Jungen und Mädchen einzurichten
Titelholzschnitt aus Luthers Schrift von 1524, gemeinfrei
Schulwesen
Schulen sind keine „Erfindung“ der Reformation. Weniger auf dem Land als vielmehr in zahlreichen Städten sind bereits für die Zeit vor der Reformation deutsche und lateinische Schulen nachgewiesen, die aus dem „Kasten“, d.h. auf Kosten der Gemeinde, unterhalten wurden. Deutschen Schulen, wie sie etwa in Tübingen bestanden, oblag die Vermittlung elementarster Kenntnisse. Gemäß den Bestimmungen der Großen Kirchenordnung waren die elementaren Fertigkeiten des Lesens und Schreibens, ferner Katechismus, Psalmen und Bibelsprüche sowie der Kirchengesang die ausschließlichen Unterrichtsgegenstände. Wenn, wie in Nellingen, der Kuhhirte zugleich der Schulmeister war, mögen Zweifel aufkommen, was davon realiter umgesetzt werden konnte. Im Beilstein des Jahres 1551 konnte von den Magistratspersonen (also Bevorrechtigten) keiner lesen und schreiben, und noch in den Ulmischen Visitationsberichten des 18. Jahrhunderts werden die Schwierigkeiten deutlich, einen einigermaßen geordneten Schulbetrieb mit qualifiziertem Personal zu gewährleisten.
In den Lateinschulen hingegen war der vermittelte Lehrstoff deutlich elaborierter: Vermittelt wurden hier vor allem lateinische Sprachkenntnisse, die Freien Künste (Grammatik, Dialektik, Rhetorik) sowie Musik. Die Lateinschulen waren sozial offen, kamen daher potentiell auch ärmeren Bevölkerungsschichten zu gute. Eine Barriere hingegen war das Geschlecht: Bei den Lateinschulen handelte es sich um reine Schulen für Jungen.
Universität
An den lateinischen Schulen wurde die zukünftige Eilte des Landes, die Juristen, die Mediziner und die Theologen, rekrutiert. An der Landesuniversität, der 1477 von Graf Eberhard im Bart gegründeten Universität Tübingen, erhielt sie ihre Ausbildung.
Die Tübinger Universität war eine kirchliche Einrichtung: Sie war mit päpstlicher Genehmigung gegründet worden; sie war ein eigener, im kirchlichen Recht gründender Rechtskörper mit entsprechenden Statuten und einem Personal, das vielfach und tief mit der katholischen Kirche verflochten war. Enge und Stabilität dieser Verbindung sind auch daran abzulesen, dass kein einziger der in Tübingen lehrenden (Theologie)Professoren sich willens zeigte, dem herzoglichen Befehl, „sich zur Predigt und Lehre des wahren Wortes Gottes bereit zu erklären“, Folge leistete. Stattdessen wurde am 18. Oktober 1534 der dezidiert altgläubige Theologe Johannes Armbruster zum neuen Rektor der Universität gewählt – ein Affront gegenüber Herzog Ulrich und seiner Regierung.
So dringlich die Unterwerfung und Domestizierung der Universität für den württembergischen Machthaber war, sie erwies sich als schwierig und außerordentlich zeitraubend. Blarer, dem diese Aufgabe übertragen worden war, erwies sich mit dieser Aufgabe als überfordert; andere, akademisch qualifiziertere Personen waren schwer zu gewinnen oder verließen Tübingen bereits nach kurzer Zeit wieder. Entscheidende Fortschritte konnten erst erzielt werden, als Johannes Brenz auf Ratschlag von Philipp Melanchthon mit der Reform der Universität beauftragt wurde. Er nahm im April 1537, unterstützt von dem Humanisten und Rektor der Universität Joachim Camerarius, seine Tätigkeit in Tübingen auf. Im selben Jahr wurden auf herzoglichen Befehl neue Statuten erlassen, die sämtlichen Mitgliedern der Universität die Teilnahme am evangelischen Gottesdienst zur Pflicht machten und ihnen ein ehrbares Leben auferlegten; zugleich wurde Ambrosius Widmann, als Kanzler Repräsentant des Papstes an der Universität und zuständig für die Verleihung von akademischen Graden, seines Amtes enthoben und aus landesherrlicher Machtvollkommenheit durch den früheren Stuttgarter Stifsdekan Johann Scheuer (von Ofterdingen) ersetzt. Sieht man von der Krise im Interim ab, war damit Entscheidendes geschehen: Der Landesherr hatte sich gegenüber „seiner“ Universität durchgesetzt, die ihrerseits durch Johannes Brenz definitiv eine dezidiert lutherische Ausrichtung bekam. Damit waren, auch wenn der Lehrbetrieb als solcher Wünsche offen ließ, für die Zukunft solide Fundamente gelegt.
Evangelisches Stift
Bereits früh, unmittelbar nach Wiederinbesitznahme und Reformation des Landes, sind Bestrebungen nachzuweisen, durch Unterstützungsleistungen den Bedarf des Landes an gelehrtem Nachwuchs sicherzustellen – in erster Linie Amtsträger und Juristen, wie sie für die herzogliche Verwaltung benötigt wurden, sowie Theologen. Im Februar 1536 wurde erste Stipendienordnung erlassen, im März des folgenden Jahres konnten die ersten Stipendiaten des herzoglichen Stipendiums an der Universität aufgenommen werden. Anfangs wohnten sie, zusammen mit anderen, an der Burse; angesichts der offenkundigen Raumnot wurde ihnen dann aber 1547, also inmitten des Schmaldkaldischen Krieges, das ehemalige Augustinerkloster als Bleibe zugewiesen. Das war die Geburtsstunde des evangelischen Stifts. Binnen dreier Jahre, also bis 1550, wurden nicht weniger als 160 Stipendiaten aufgenommen, eine mehr als beträchtliche Zahl. 86 von ihnen studierten Theologie; neun weitere wurden später Lehrer, neun Juristen, vier Mediziner. Die Ausrichtung ist offenkundig: Das Stift war in erster Linie eine Ausbildungsstätte für Theologen.
Die Modalitäten des Studiums im Stift wurden in der Ordnung von 1557 grundlegend geregelt und in der Großen Kirchenordnung von 1559 geringfügig modifiziert: Die Zahl der Stipendiaten wurde nunmehr auf 100 festgelegt, um durch den Landtagsabschied von 1565 auf 150 erhöht zu werden. Durch die dergestalt gestiegene Zahl von Stipendiaten waren bauliche Erweiterungsmaßnahmen unabdingbar: Im Südflügel wurde die Communität, der Speisesaal, geschaffen, darüber im alten Dorment die Schlafsäle eingerichtet; im Nordflügel wurden auf die alte Klosterkirche zwei Geschosse aufgesetzt, um weitere Stipendiaten, Verwaltungsräume und Wohnungen für die Vorsteher des Stifts einrichten zu können.
Man kann sich fragen, ob das unter Herzog Christoph geschaffene, vorwiegend auf die Ausbildung von Theologen zielende Ausbildungssystem mit Lateinischen Schulen, Klosterschulen und Stift nicht „überdimensioniert“ war. Außer Frage steht jedenfalls, dass in Württemberg bereits im 16. Jahrhundert deutlich mehr Theologen „produziert“ wurden, als das Land selbst benötigte. Vielfach waren deshalb in Württemberg ausgebildete Theologen andernorts anzutreffen. Gänzlich ungewollt war dies sicherlich nicht, beförderte es doch den Einfluss der württembergischen Herrscher und das Ansehen „seiner“ Kirche.
4.10: Das Interim: Bewährungsprobe der Reformation
Bereits unmittelbar nach der Einführung der Reformation, im Jahre 1536, hatte sich Herzog Ulrich dem Schmalkaldischen Bund angeschlossen. Geführt von den beiden Hauptleuten, dem sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich und dem hessischen Landgrafen Philipp, sollte dieses Militärbündnis seine Mitglieder vornehmlich im Falle eines aufgenötigten Religionskrieges – „allein zur gegenwehr und rettungsweise“ – schützen; zudem galt es das aus obrigkeitlichen Rechten abgeleitete Recht der Bundesgenossen, in ihren Besitzungen die Reformation einzuführen, politisch abzustützen.
Als der Kaiser kurz nach dem Tode Martin Luthers am 18. Februar 1546 die Reichsacht über den Kurfürsten von Sachsen und den hessischen Landgraf verhängen ließ, beendete er definitiv jene um 1540 begonnene Politik, zwischen den konfessionellen Lagern einen auch theologisch tragbaren Ausgleich vermitteln zu wollen. Als Grund für die Acht wurde die Gefangenahme Herzog Heinrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel benannt, eine Folge des Wolfenbüttelerzugs der beiden Schmalkadischen Hauptleute des Jahres 1542. Damit sollte Eindruck vermieden werden, der Kaiser ziehe gegen die Evangelischen ob ihrer Religion ins Feld – eine Ansicht, die in zahlreichen Traktaten der protestantischen Publizistik lautstark vertreten wurde.
Für Herzog Ulrich von Württemberg war der Krieg bereits im März 1546 zu Ende. In Ulm bat er den siegreichen Kaiser um Abbitte und Entschuldigung, sitzend, weil er den geforderten Fußfall „Leibes halber“, wegen seiner Gicht, nicht leisten konnte. Kontributionen, die Übergabe der drei Landesfestungen Asperg, Neuffen und Schorndorf waren die sofortige, das erzwungene kaiserliche Religionsgesetz, das Interim, die kurz darauf eintretende Folge der militärischen Niederlage. Die Zugeständnisse des Kaisers waren bescheiden – gewährt wurden lediglich das Abendmahl unter beiderlei Gestalt sowie die Priesterehe. „Aus Gehorsam gegen den Kaiser“ willfuhr der Württemberger: das Interim musste von den Kanzeln des Landes verkündet, am 11. November 1548 sogar die Messe wieder eingeführt werden. Zudem künden weitere, vom Kaiser erzwungene herzogliche Erlasse von der Not des Landesherrn, in dessen restituierten Klöstern wieder katholische Äbte und Mönche residierten. Die Krise war allumfassend, sie bedrohte den Fortbestand der Reformation ebenso wie die territoriale Integrität des Landes.
Widerstand gegen das Interim regte sich vor allem bei den Geistlichen. Zahlreiche von ihnen, darunter Erhard Schnepf, wurden genötigt, das Land zu verlassen. Sie teilten damit das Geschick der reichsstädtischen Prediger, die massenhaft ins Exil gezwungen wurden. Auch Johannes Brenz musste aus Schwäbisch Hall flüchten, hielt aber die Verbindung zu Herzog Ulrich bzw. seinem ihm inmitten der Krise auf den Thron folgenden Sohn Christoph (Nov. 1550). Bereits im Februar 1549 wagte er die Hoffnung auszusprechen, dass im Land „der glimmende Docht“ wieder angebrannt werde.
Bis sich diese Hoffnung erfüllte, sollten noch mehrere Jahre vergehen. Allerdings vergrößerten sich die Handlungsmöglichkeiten von Herzog und Geistlichkeit langsam, aber stetig: Bereits früh waren die abgesetzten Prediger zu Katecheten bestellt und meist aus den Armenkästen besoldet wurden – eine subtile Strategie, das Interim zu unterlaufen und die freie Predigt des Evangeliums trotz widriger Zeitumstände zu ermöglichen. Gegen die vielfach unbeliebten Messpriester konnte vorläufig allerdings nur vorsichtig vorgegangen werden, zumal ein Prozess wegen Felonie (Lehensuntreue) noch im Raum stand. Erst die geänderten und politischen Rahmenbedingungen, die ihren Niederschlag im Passauer Vertrag fanden (2. Aug. 1552), besiegelten das Ende des Interims in Württemberg: Am 12. August 1552 wurde den beiden letzten Messpriestern im Auftrag des Herzogs eröffnet, dass Messe und Zeremonien nach herzoglichem Willen „als ein seiner christlichen Konfession und göttlicher Schrift unangemessener Gottesdienst“ nicht weiter geduldet würden. Zuvor, am 30. Juni, war der Befehl ergangen, die Messe „bis auf weiteres“ im gesamten Land einzustellen.
4.11: Confessio Virtembergica
Noch bevor die Macht des Kaisers durch den Aufstand der Fürsten ins Wanken geriet, war in Trient das Konzil wieder eröffnet worden. Als einer der wenigen protestantischen Reichsstände gedachte sich der Württemberger vor diesem Konzil zu verantworten. Zu diesem Zwecke beaufragte Herzog Christoph den bereits heimlich wieder im Land weilenden Brenz, ein eigenes Glaubensbekenntnis auszuarbeiten, die Confessio Virtembergica. Gedacht war sie als „Gesprächsangebot“ (Brecht) an die Gegenseite. Diesem Anliegen konform war der Aufbau, der Artikel für Artikel positive Anknüpfungspunkte in der katholischen Lehre zu finden bestrebt war, um dann die evangelische Auffassung darzulegen – untermauert mit Schrift- und Väterzitaten. Bei der Rechtfertigungslehre konnten demzufolge die geistlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung und gute Werke gewürdigt werden, ohne das sola gratia in Frage zu stellen; und bei allen Zugeständnissen, die an die katholische Auffassung vom Nachtmahl gemacht wurden, vermochte Brenz den Opferbegriff nur unter der Prämisse zu akzeptieren, dass damit der gesamte Gottesdienst bezeichnet werde. Grundsätzlich abgelehnt wurden die Stillmesse, die Messe als Opfer für Lebendige und Tote sowie die Prozessionen mit dem Sakrament.
Die Confessio Virtembergica war dazu bestimmt, die theologischen Kernanliegen der Reformation auf dem Trienter Konzil darzulegen und zu verteidigen. Dies unterbleib, weil Verfahrensfragen die Vorsprache der württembergischen Räte und Theologen so lange verzögerten, bis Papst Julius III. (1550-1554) das Konzil aufgrund der drohenden Konflikte in Deutschland (Fürstenaufstand) erneut suspendierte. Eine inhaltliche Auseinandersetzung der Konzilsväter mit dem württembergischen Bekenntnis fand daher nicht statt. Gleichwohl kam es um die Confessio zu einer erbitterten literarischen Auseinandersetzung, die durch einen prominenten katholischen Theologen ausgelöst wurde, den Dominikaner Pedro de Soto, langjähriger Beichtvater Karls V. und zwischenzeitlich Professor an der Universität Dillingen. Seine 1555 in Köln erschienene „Assertatio catholicae fidei“, ein katholisches Bekenntnis gegen die Confessio Virtembergica, sowie weitere Schriften veranlassten Johannes Brenz und andere zu ausführlichen Widerlegungen – beginnend mit der von Brenz stammenden Apologie, die in mehreren Lieferungen zwischen 1555 und 1559 erschien, endend mit dem ob seines Umfangs so genannten Großen Buch von Tübingen, einer Gemeinschaftsarbeit der namhaftesten Theologen des Landes (Johannes Brenz, Jakob Beuerlin, Jakob Heerbrand, Johann Eisenmenger und Dietrich Schnepf).
4.12: Das Ende der Reformation in Württemberg
-
Herzog Christoph von Württemberg in spanischer Tracht, Ölgemälde, nach 1568
Kunsthistorisches Museum Wien
Die Große Kirchenordnung von 1559
Die Confessio Virtembergica bildete als herzogliches Bekenntnis das theologische Fundament, auf dem die neue evangelische Kirche errichtet wurde. Ihrem Selbstverständnis nach eine Wiederholung der Augsburger Konfession von 1530, wurde sie eben deswegen der sog. Großen Kirchenordnung des Jahres 1559 vorangestellt. Mit ihr gelangt die Neuordnung des Kirchenwesens in rechtlicher Hinsicht zu einem Abschluss. Unter dem Titel „Summarischer und einfältiger Begriff, wie es mit der Lehre und Ceremonien in den Kirchen unseres Fürstenthumbs, auch derselben anhangende Sachen und Verrichtungen, bißher geübt und gebraucht, auch fürohin mit verleihung Göttlicher gnaden gehalten und volzogen werden soll“, vereinte sie insbesamt 19 verschiedene Ordnungen, deren Befolgung die irdische Wohlfahrt und ein christliches Leben verbürgen sollte. Für Württemberg selbst wurde die Große Kirchenordnung für Jahrhunderte wegweisend; und auch wenn sie die ihr wohl zugedachte Rolle einer Musterordnung für das evangelische Deutschland des 16. Jahrhunderts nicht einnehmen konnte, reichte ihre enorme Ausstrahlungskraft doch weit über die Landesgrenzen hinaus.
Der Landtagsabschied von 1565
Nach dem theologischen (Confessio Virtembergica) und dem kirchenordnenden (Große Kirchenordnung) markiert der Stuttgarter Landtag des Jahres 1565 den definitiven politisch-verfassungsrechtlichen Abschluss der Reformation. Nach zähem Ringen mit den an der Herrschaft beteiligten Ständen bestätigte Herzog Christoph gegen die Übernahme seiner Kammerschulden die Augsburgische und Württembergische Konfession als Grundlage des Konfessionsstandes des Landes und anerkannte die ständische Verfassung mit der Landschaft als Gesamtheit der Vertreter von Städten und Ämtern un den nunmehr evangelischen Prälaten als Vertreter der Klöster und Klostergebiete. Zudem versprach er, seine Nachfolger auf diese Konfession durch ein entsprechendes Testament zu verpflichten. Im Benehmen mit dem Herzog, der damit auf sein obrigkeitliches Reformationsrecht verzichtete, war nunmehr auf Drängen von Prälaten und Landschaft die lutherische Konfession auch für zukünftige Zeiten sichergestellt.
5: Theologie und Politik: Das Herzogtum Württemberg 1550 - 1650
5.1: Das konfessionelle Zeitalter
-
Karte: Württemberg im Zeitalter der Reformation
Aus: Hermann Ehmer, Reformation in Schwaben, DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen, 2010. Mit freundlicher Genehmigung.
Mit dem Begriff des konfessionellen Zeitalters beginnt die zweite Etappe einer Epoche in der frühen Neuzeit. Für die Zeit zwischen der Mitte des 16. Jahrhunderts und der Mitte des 17. Jahrhunderts wird terminologisch ein Merkmal der europäischen und insbesondere der deutschen Geschichte hervorgehoben, die „Konfessionalisierung“. Betont wird damit zweierlei: Die prinzipiell vergleichbare, weil gleichgerichtet ablaufende Formierung von drei Konfessionen – Katholizismus, Luthertum und Reformierte – als institutionell verfasste Großkirchen auf der Basis verbindlicher Lehrgrundsätze mit Anspruch auf Regulierung der alltäglichen Lebensformen; die Annahme einer grundlegenden Bedeutung des Faktors „Konfession“ nicht nur für den engeren kirchlichen Bereich, sondern darüber hinaus für Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft.
Im wissenschaftlichen Konzept der Konfessionalisierung wird diese grundlegende Bedeutung von Konfession im Sinne eines „gesellschaftlichen Fundamentalvorgangs“ (Schilling) zu fassen versucht, dem entscheidende Impulse für die Modernisierung Europas zugeschrieben wird. Obwohl sowohl die allgemeinhistorische als auch die kirchengeschichtliche Forschung diesem Ansatz wichtige Impulse verdanken, war und ist er nicht unumstritten. Aus kirchengeschichtlicher Perspektive wurde vor allem bemängelt, dass das Konzept den Unterschieden zwischen den Konfessionen zu wenig Rechnung trage. Dieses fraglos bestehende Defizit zu beheben, ist ein zentrales Anliegen des Konzeptes der Konfessionskulturen (Kaufmann).
Anzumerken bleibt, dass sich im Reich die Gewichte zwischen den sich konsolidierenden Großkirchen wie auch zwischen evangelischen und protestantischen Reichsständen signifikant verschoben: Von der Dynamik, welche die Reformation in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kennzeichnete, ist in der zweiten Hälfte zunehmend weniger zu spüren. Die Jahre zwischen 1555 und 1648 sind eher, vor allem ab 1580, gekennzeichnet von einem sich konsolidierenden Katholizismus, der dann im 30jährigen Krieg sogar das Übergewicht zu gewinnen droht.
5.2: Feinbild Katholiken: Reichspolitik und Kontroversliteratur
Reichspolitik
Entgegen einer auch heute noch gängigen Forschungsmeinung war der Augsburger Religionsfrieden allenfalls bedingt geeignet, um mit den Mitteln des Rechts den „Zwiespalt in der Religion“ einer tragfähigen Lösung zuzuführen und damit dauerhaft zum Frieden im Reich beizutragen. „Wirklich tragfähig“ war der Augsburger Reichsabschied deswegen nicht, weil zahlreiche Streitfragen nur vordergründig gelöst waren: So ließ der Wortlaut des Reichsabschiedes unterschiedliche, sich widersprechende Interpretationen zu oder klammerte strittige Fragen vollkommen aus; zudem wurde die Verbindlichkeit einzelner Bestimmungen gänzlich bestritten. Dies gilt etwa für die Ausführungen zum reichsmittelbaren Kirchengut, zu den bikonfessionellen Reichsstädten, zum geistlichen Vorbehalt, zur Declaratio Ferdinandea oder zur Frage, auf welchen Rechten der landesherrliche Religionsbann aufruhe und wie zu verfahren sei, wenn verschiedene Rechte konkurrierten oder mehreren ungeteilt zustünden. Der Religionsfrieden war, so Axel Gotthard, ein „dissimulierender Formelkompromiss“. (20) Diesem seinem Charakter war es zu verdanken, dass der Religionsfriede überhaupt hatte geschlossen werden können; ihm war es aber auch geschuldet, wenn insbesondere ein Teil der evangelischen Reichsstände versuchte, zentrale, in ihrer Perspektive unzulängliche Ergebnisse des Augsburger Reichstags von 1555 erneut zum Gegenstand von Verhandlungen auf den Reichstagen zu machen.
Treibende Kräfte hierbei waren vor allem die Kurfürsten von der Pfalz sowie der württembergische Herzog Christoph. Gegen das dezidierte Votum seiner Räte (Severin von Massenbach und Balthasar Eislinger), die dargelegt hatte, dies werde nur „grosse zerrittung und enderung im reich“ evozieren, versuchte der württembergische Herzog auf den Reichstagen von 1556 und 1559 die allgemeine Freistellung, zumindest aber die Aufhebung des reservatum ecclesiasticum zu erreichen. Damit wäre auch die geistlichen Reichsständen sowie den Untertanen katholischer Reichsstände ein mit keinerlei Nachteilen verbundener Übertritt zur Augsburger Konfession offen gestanden. Ein substantieller Erfolg seiner Bemühungen blieb ihm allerdings versagt – zu stark war der Widerstand des Reichsoberhauptes und der katholischen Reichsstände, zu disparat das Erscheinungsbild der evangelischen. Zudem befanden sich die Württemberger selbst in einem politischen Dilemma: Denn auch wenn sie auf der einen Seite als hardliner gesamtprotestantischer Interessen agierten, so wenig wollten auch sie den Religionsfrieden als solchen in Frage gestellt wissen. In diesem Konflikt divergierender Interessen aber war die letztendliche Bereitschaft zum politischen Kompromiss schon angelegt.
Kontroversliteratur
In den Auseinandersetzungen mit den katholischen Reichsständen und Theologen kam der Kontroversliteratur zentrale Bedeutung zu. Zahlreiche Schriften stammten dabei aus der Feder württembergischer Theologen, etwa von Jakob Andreä, Johannes Brenz, Jakob Heerbrand oder Lukas Osiander.
Vor allem gegen die Jesuiten, die als intellektuelle, wort- und schriftgewandte Speerspitze der Gegenreformation maßgeblich zu deren Erfolg betrugen und dadurch vor allem bei der theologischen Elite der Lutheraner Bedrohungsängste evozierten, richteten sich zahlreiche Schriften. Als die Gegner Jesu schlechthin – daher die Diskreditierung als „Jesuwider“ – symbolisierten sie das unerwartete Erstarken der Papstkirche, das vor einem apokalyptischen Zeithorizont gedeutet wurde. Vor der akuten Gefahr, die von ihnen ausging, galt es die Bevölkerung zu warnen: „die Iesuiter sein die hund/ darmit der bapst thut jagen. / Wo sie ein schäflen finden ston: /Von dannen thon sis tragen“. (21) Und auch die Polemik gegen den Gregorianischen Kalender, den Papst Gregor XIII. am 14. Februar 1582 in der katholischen Welt einführte, war weniger durch die angeblichen oder wirklichen Mängel bedingt, die er aufwies, als durch die Tatsache, dass er durch ein päpstliches „Mandamus“, wir befehlen, eingeführt worden war. Nun schieden sich Protestanten und Katholiken nicht nur theologisch, sondern auch durch die jeweils eigene Zeit, in der sie lebten.
Die Polemik gegen die Katholiken wurde in gelehrten Diskursen ebenso ausgetragen wie allgemeinverständlichen, vereinfachten Formen. Dies schied sie von den innerprotestantischen Differenzen, auf die im Folgenden einzugehen ist. Diese waren weithin Kontroversen in der Hochtheologie, die zwischen theologischen Experten ausgetragen wurden. Der „gemeine Mann“ sollte von diesen Auseinandersetzungen so weit als möglich verschont werden. Dies gibt sowohl die lateinische Sprache der Publikationen zu erkennen als auch das mediale Format der gewechselten Streitschriften. Kleinschriften, Flugblätter oder Flugschriften wird man hier vergeblich suchen, stattdessen dominieren mehr oder minder dickleibige Darlegungen in Quart oder Folio.
5.3: Innerprotestantische Konflikte und Einigungsbestrebungen
Zerstritten – die protestantischen Reichsstände und ihre Theologen
In der Auseinandersetzung mit den katholischen Reichsständen und katholischen Theologen profilierten sich der württembergische Herzog und seine Geistlichen als hardliner. Völlig anders agierten sie im jüngst so genannten binnenkonfessionellen Diskurs, also den Auseinandersetzungen innerhalb des Luthertums: Hier präsentierte sich Herzog Christoph von Württemberg bereits in den frühen 1550er Jahren als Versöhner und Mahner zur Einheit. Er gab damit Impulse, welche die württembergische Religionspolitik bis zur Publikation des Konkordienbuches (1580) maßgeblich beeinflussen sollten. Eine ähnlich herausgehobene Bedeutung des württembergischen Herzogtums für die Geschichte des deutschen Protestantismus wird man für die Zeit danach vergeblich suchen. Erst im kirchlichen Einungswerk eines Theophil Wurms findet sich ein – allerdings schwächeres – Äquivalent.
Für Herzog Christoph von Württemberg wie für seine theologischen Berater, allen voran Johannes Brenz, war die Sorge um die Einheit aller Evangelischen ebenso selbstverständliche religiöse Verpflichtung wie unabweisbare politische Notwendigkeit. Denn die zahlreichen innerprotestantischen Streitigkeiten, eingebettet in den innerdynastischen Konflikt des Hauses Wettin um das theologische Erbe Luthers, schädigten nicht nur in der Wahrnehmung des Württembergers das Ansehen der protestantischen Reichsstände wie ihrer Theologen vor der reichischen Öffentlichkeiten, sie waren auch dem „gemeinen Mann“ ein stetes Ärgernis und Stein des Anstoßes. Zudem boten sie dem konfessionellen Widersacher eine exzellente Angriffsfläche. Daher gelte es zu verhindern, dass der durch die Reformation in die Defensive gedrängte leidige Satan „seiner art und aigenschaft nach als ain vatter der leugin und unfridens“ den Protestanten schade, konkret: „die unsern in geschrai bringe bringen, als sollten weder die stend noch ire theologi und kirchendiener irer ler halben nicht verglichen oder derselbigen ainhellig under ainander sein“. (22)
Einigungsversuche unter dem Primat der Politik
Die Einheit aller Protestanten, zumindest aber der Augsburger Konfessionsverwandten war dem Herzog ein persönliches Anliegen. „Wie ein Mann“ sollten sie zusammenstehen und in ihrem geschlossenen Auftreten ein Bild der Stärke bieten, attraktiv für den eigenen Glaubensgenossen und religiös Unentschiedene, abschreckend für ihre Gegner und Widersacher. Um diese Einheit zu erreichen, schien es dem Württemberger geboten, nicht auf die notorisch streitsüchtigen Theologen zu setzen, sondern auf die christliche Obrigkeit, die Fürsten. Unter ihrer Regie, unter Beziehung „friedliebender“ Geistlicher, sollten die bestehenden Differenzen ausgeräumt werden. Einheit in der Lehre, Gleichförmigkeit in den kirchlichen Ordnungen und Zeremonien – dies war letztendlich das Ziel, das Herzog Christoph von Württemberg vor Augen schwebte. Obwohl ihn seine theologischen Berater, allen voran Johannes Brenz, wie auch seine weltlichen Räte wiederholt vor zu viel Optimismus warnten und bescheidenere Zielsetzungen anmahnten, zeigte sich der Herzog nur begrenzt einsichtig. Zu seinen Gunsten sprach, dass die württembergischen Theologen in die innerprotestantischen Kontroversen kaum involviert waren, der Herzog mithin die Position eines neutralen Außenseiters anstreben konnte. Hinderlich dagegen war, dass der Württemberger nicht zu den Meinungsführern unter den protestantischen Reichsständen zu rechnen war. Diese Rolle fiel anderen zu – in erster Linie den durchweg protestantischen weltlichen Kurfürsten (Pfalz, Sachsen, Brandenburg), aber auch Herzog Johann Friedrich dem Mittleren, der vom kulturellen Kapital seines Hauses und „dessen“ Theologen (Martin Luther) zehrte.
Unter diesen Auspizien konnte der württembergische Herzog, vielfach im Zusammenspiel mit Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz, zwar mehrfach wichtige religionspolitische Impulse setzen und sich Gehör in den – oft widerwillig anberaumten – Verhandlungen verschaffen, erstmals mit einem Treffen in Naumburg (1554), zuletzt auf dem Naumburger Fürstentag (1561). Der eigentliche Gewinner aber war der sächsische Kurfürst August. Politisch der unangefochtene Meinungsführer unter den protestantischen Reichsständen, gelang es ihm je länger, desto besser, auch im binnenkonfessionellen Diskurs den Ton vorzugeben. Sein Anliegen war allerdings ein gänzlich anderes als das des Württembergers: Statt die bestehenden Differenzen inhaltlich zu bereinigen, war dem Kurfürsten daran gelegen, sie nach Möglichkeit nicht zu thematisieren. Mit dem Naumburger Fürstentag, wo man sich definitiv auf eine neue Unterzeichnung der Augsburgischen Konfessionen und die „Unterdrückung der theologischen Zänckereien“ verständigte, hatte er sein Ziel erreicht. Insofern war der Sieg des sächsischen Kurfürsten eine Niederlage des württembergischen Herzogs.
Württemberg und die reformierte Wende in der Kurpfalz
Das Scheitern des Württembergers erwies sich als umso gravierender, als sein bisheriger religionspolitischer Verbündeter, die Kurpfalz, unter sich konfessionell neu zu orientieren begann. Der seit 1559 regierende Kurfürst Friedrich III. (1515-1576) führte die Abendmahlslehre und Zeremonien der Reformierten ein, besetzte die Pfarrstellen und die Lehrstühle der Heidelberger mit reformierten Theologen und ließ 1563 mit dem Druck der neuen Kirchenordnung und des Heidelberger Katechismus die neue Positionierung der Kurpfälzer Kirche öffentlich „dokumentieren“.
Am Stuttgarter Hof war die Entwicklung in der benachbarten Kurpfalz stets misstrauisch beobachtet worden. Bereits im Dezember 1559 hatte Herzog Christoph in einem eigenhändigen Schreiben den Heidelberger vor den Gefahren des Zwinglianismus gewarnt, drei Jahre später sprach er in einem Schreiben an Kurfürst August dann offen vom calvinistischen Irrtum des Pfälzers. Die Publikation von Kirchenordnung und Katechismus waren für den Württemberger dann der endgültige Beweis dafür, dass „die eigentliche Gefahr für die Einheit des deutschen Protestantismus ... in Heidelberg zu suchen sei“. (23)
Bekanntlich reagierte Herzog Christoph 1563 höchst differenziert auf das „Ausscheren“ der Kurpfalz: Er versuchte über Kurfürst August, eine gemeinsames Vorgehen aller protestantischen Reichsstände gegen den Kurpfälzer zu bewerkstelligen, und er betrieb als Nukleus befreundeter, benachbarter Fürsten eine niederschwellig angesiedelte Politik inhaltlicher Konsensfindung („privat colloquio“), die schließlich in das Maulbronner Kolloquium (April 1564) mündete. Dieses war „nichtöffentliches Expertengespräch“ geplant und sollte vor allem den Differenzen in der Abendmahlsfrage gelten – jener Streitfrage, in der bereits früh verschiedene Auffassungen unter den Reformatoren bestanden hatten. Auf württembergischer Seite waren Johannes Brenz, Balthasar Bidembach, Jakob Andreä (der nahezu ausschließlich die Auseinandersetzung bestritt), Dietrich Schnepf und Valentinus Vannius als Kolloquenten benannt; auf Kurpfälzer Seite diskutierten Michael Diller, Peter Boquin, Kaspar Olevian, Zacharias Ursinus und Peter Dathen. Beide Fürsten, sowohl Herzog Christoph als auch Friedrich III., waren persönlich anwesend – in insgesamt zehn Sitzungen ab morgens sechs Uhr.
Faktisch endete das Gespräch ohne jede Annäherung, befördert durch den Umstand, dass es den Pfälzer Theologen gelungen war, die (auch innerhalb des Luthertums umstrittene) Brenzsche Ubiquitätslehre und nicht das Abendmahl ins Zentrum der Auseinandersetzung zu rücken. Dass überdies – entgegen der ursprünglichen Abmachung – beide Seiten „Acten“ des Kolloquiums veröffentlichten, in denen sie jeweils den „Sieg“ für ihre Seite reklamierten, trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Beziehungen zwischen Heidelberg und Stuttgart (weiter) verschlechterten.
Ob die inhaltliche Verständigung im Austausch der theologischen Experten wirklich das einzige und zentrale Ziel der württembergischen Politik gewesen ist, mag bezweifelt werden. Eher ist davon auszugehen, dass die Verständigung in der Sache lediglich eine Option württembergischer Politik darstellte; die andere bestand in dem Ausweis, alles versucht zu haben, um Heidelberg zu überzeugen und so eine Verständigung herbeizuführen. Für diese Option könnte sprechen, dass es die Württemberger waren, die zuerst ihre Version des Religionsgespräches der Öffentlichkeit zugänglich machten. Der Nachweis der Unmöglichkeit, die theologischen Differenzen im Austausch der Argumente zu bereinigen, konnte nun dazu dienen, den zusammen mit Pfalz-Zweibrücken beschrittenen Kurs der Konfrontation zu legitimieren und das Reichsoberhaupt ins Spiel zu bringen. Bereits im Januar 1563 hatte Christoph den römischen König und späteren Kaiser Maximilian II. in einer ausführlichen Denkschrift über die innerprotestantischen Differenzen informierte und ihm Vorschläge unterbreitet, „wie solches alles fueglich möchte beigelgt vnnd verglichen werden“. Der Vorstoß des Württembergs und die internen Entscheidungsfindungsprozesse am kaiserlichen Hof zu Wien trafen sich im entscheidenden Punkten, dem Rekurs auf das Reichsrecht. Weil der in Augsburg vereinbarte Religionsfriede sich nur auf die Katholiken einerseits, die Anhänger der Confessio Augustana andererseits beziehe, wurde der Friedrich III. aufgefordert, entweder zum Luthertum zurückzukehren oder der Ächtung durch den Kaiser gewärtig zu sein. In den ausschlaggebenden Verhandlungen auf dem Augsburger Reichstag 1566 war es aber eine Mehrheit der protestantischen Reichsstände, die sich dieser Alternative widersetzte – vor allem deshalb, weil dem Kaiser nicht das Recht eingeräumt werden sollte, seinerseits über die Rechtgläubigkeit evangelischer Obrigkeiten zu entscheiden.
Für Herzog Christoph von Württemberg, der sich wie Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken auch auf dem Reichstag als Gegner des Heidelberger Kurfürsten exponiert hatte, war das Ergebnis des Reichstags in der Pfalzfrage eine politische Niederlage erster Güteklasse. Der Versuch, den einstigen Verbündeten religionspolitisch (wieder) „auf Kurs“ zu bringen, wieder war nach wiederholten Anläufen definitiv gescheitert; der Dissens innerhalb der protestantischen Reichsstände war größer denn je, und die Beziehungen zu Kaiser Maximilian sollten irreparabel beschädigt werden. In den wenigen ihm noch verbleibenden Lebens- und Regierungsjahren beschränkte sich der Württemberger bezeichnenderweise auf jene Politikbereiche, in denen er die größten Erfolge vorzuweisen hatte – den Schwäbischen Kreis und die angestammten Lande. Seine reichspolitische Agenda hatte er nicht durchzusetzen vermocht – die Einheit aller Protestanten, die ihm zeitlebens stets zentral bedeutsam gewesen war, war am Ende seiner Regierung (er starb am 28. Dezember 1568) so fern wie zu deren Beginn.
Einigungsversuche unter dem Primat der Theologie: Die Konkordienformel
Erste Impulse, um die innerprotestantischen Differenzen erneut anzusprechen, speisten sich aus der Bitte Herzog Julius von Braunschweig, Württemberg möge ihn bei der Einführung der Reformation in seinen welfischen Stammlanden unterstützen. Wenig später, 1571, bekundete der der Welfe dann gegenüber Herzog Ludwig, dem Sohn und Nachfolger Christophs, seinen Wunsch nach einer Lehrvereinigung seiner Kirche mit den Nachbarkirchen. Dieser beauftragte seinen fähigsten Kirchenmann, den Professor der Theologie und Kanzler der Tübinger Universität Jakob Andreä, sich der Angelegenheit anzunehmen.
Die Einigung der lutherischen Kirchen sollte das Lebenswerk des in Göppingen als Sohn eines Schmieds (daher sein Spitzname Schmidlin) geborenen Theologen werden – Verfasser von mehr als 150 theologischen Schriften und einer Autobiographie. Einen wichtigen Meilenstein markieren die „Sechs christlicher Predigt von den Spaltungen“, die Andreä 1573 in Memmingen publizierte. In ihnen behandelte er wichtige innerprotestantischen Streitfragen – Rechtfertigung, gute Werke, Erbsünde, freier Wille, Mitteldinge (Adiaphora), Gesetz, das Verhältnis von Gesetz und Evangelium, die Bedeutung des Gesetzes für die Gläubigen (tertius usus legis), schließlich die Person Christi. Wegweisend wurden diese Predigten vor allem deswegen, weil Andreä einen Grundkonsens in den strittigen Fragen zu intonieren versuchte, der aber auf die Lutheraner beschränkt blieb. Bewusst wurde darauf verzichtet, die Calvinisten und die Philippisten zu gewinnen. Eine Anregung des Braunschweiger Superintendenten Martin Chemnitz aufgreifend, der bemängelt hatte, die Form der Predigt tauge nicht für den angestrebten Zweck binnenkonfessioneller Konsensfindung, arbeitete Andreä die Predigten noch im selben Jahr 1573 in Artikel um. Bereits im November lag die Schwäbische Konkordie (so genannt, weil sie von den württembergischen Theologen anerkannt wurde) vor – die theologische Substanz der Predigten, nun in Artikel verfasst und um insgesamt 11 weitere Artikel vermehrt, mit Erklärungen über das Abendmahl, die Prädestination und die „Rotten und Sekten“.
Entscheidende Fortschritte machte das Konkordienwerk allerdings erst, als sich Kurfürst August nach dem Sturz als heimliche Calvinisten diskredierter Theologen und Politiker in Kursachen (sog. Kryptocalvinisten) im November 1575 des „Einungswerkes“ annahm. Ihm gelang es, Andreä für mehrere Jahre in seinen Dienst zu ziehen und mit dieser Aufgabe zu betrauen. Am 28. Mai 1577 konnte dem Kurfürsten das sog. Bergische Buch vorgelegt werden, eine mit der theologischen Autorität Jakob Andreäs, Martin Chemnitzers, Nikolaus Selneckers, Andreas Musculus, Chrstoph Cornerus und David Chyträus versehene und in eine endgültige Form gebrachte Bekenntnisschrift, gefasst als „allgemeine, lautere, richtige und endliche Wiederholung und Erklärung etlicher Artikel Augsburgischer Konfession, in wölchen ein Zeither unter etlichen Theologen Streit vorgefallen, nach Anleitung Gottes Worts und summarischen Inhalts unser christlichen Lehre beigelegt und verglichen („Solida Declaratio“). Die solida declaratio enthält:
-
einen Vorbericht, in dem die Gültigkeit des Augsburger Bekenntnisses betont und zugleich erkärt wird, das es einige Artikel näher zu erläutern gelte;
-
eine Darlegung, auf welche Grundlagen die Lehre der Kirche zu stützen sein (die Schrift; die altkirchlichen drei ökumenischen Symbole; die Confession Augustana (invariata); die Apologie; die Schmalkaldischen Artikel Martin Luthers sowie dessen kleiner und großer Katechismus);
-
eine Erklärung, in der alle Ketzereien und Irrtümer der Vergangenheit verworfen werden und erklärt wird, dass im Folgenden die rechte Lehre in den durch das Interim strittig gewordenen Artikeln dargelegt werde (Von der Erbsünde; Vom freien Willen oder menschlichen Kräften; Von der Gerechtigkeit des Glaubens für Gott; Von den guten Werken; Vom Gesetz und Evangelio; Vom dritten Brauch des Gesetzes Gottes; Vom heiligen Abendmahl; Von der Person Christi; Von der Hellfahrt (Höllenfahrt) Christi; Von den Kirchengebräuchen, so man Adiaphora oder Mittelding nennt; Von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes; Von andern Rotten und Sekten, so sich niemals zu der Augsburgischen Konfession bekennet).
Die Solida Declaratio war von den sechs in Bergen versammelten Theologen unterzeichnet. Um ihr allgemeine Anerkennung seitens der protestantischen Obrigkeiten und Theologen zu verschaffen, war ursprünglich ein Generalkonvent der protestantischen Stände vergesehen, von dem dann aber Abstand genommen wurde. Statt dessen wurde – über regionale „Knotenpunkte“ (Dresden, Berlin, Wolfenbüttel, Stuttgart und Braunschweig) – in Einzelwerbungen um Zustimmung geworben. Sorgfältig unterschieden wurde dabei zwischen den protestantischen Reichsständen (zu denen, da übergangen, die Reichsritterschaft offenkundig nicht gezählt wurde), die die Vorrede unterzeichnen sollten, und den Kirchen- und Schuldiener, welche die Solida declaratio (und damit das inhaltliche Substrat der Einigung) zu unterzeichnen hatten. Die Unterschrift leisteten schließlich drei Kurfürsten, 20 Fürsten, 24 Grafen, 4 Freiherren und 35 Reichsstädte einerseits, über 8.000 Kirchendiener andererseits. Rein numerisch betrachtet war das Ergebnis somit durchaus beeindruckend. In Rechnung zu stellen ist aber, dass eine durchaus stattliche Zahl von Reichsständen sich weigerten, die Unterschrift zu leisten, oder die geleistete Unterschrift entwerteten, weil sie sich desungeachtet von der lutherischen Konfession abwandten. Mit Blick auf die Reichsstände trennten sich mithin an der Konkordie die Wege. „Mit ihr endet … die Reformation, und spätestens hier beginnt auch zwischen den beiden reformatorischen Richtungen das konfessionellen Zeitalter“. (24)
5.4: Umgang mit einer äußeren Bedrohung: Türkengefahr
„Der Türke ist der Lutheraner Glück“. Diesen für uns heute unverständlichen, ja provokant klingenden Satz äußerte 1576 der Hofprediger des katholischen Erzherzogs Karl II. von Steiermark, Kärnten und Krain. Was war damit gemeint?
1531 standen türkische Truppen erstmals vor Wien. Die Lage war mehr als bedrohlich, der Fall der Stadt schien kurz bevorzustehen. Ein Krieg gegen die Protestanten, wie er von Karl V. auf dem Augsburger Reichstag 1530 nachweislich erwogen wurde, war damit unmöglich geworden, denn der Kaiser bedurfte der finanziellen wie militärischen Unterstützung auch der protestantischen Reichsstände. Eine Konsequenz hieraus war der Nürnberger Anstand, der zwar die religionspolitischen Probleme keiner Lösung zuführte, aber die vor dem Reichskammergericht drohenden Prozesse in Religionssachen aussetzte. Ein rechtlicher Krieg gegen die als „Kursachsen und seine Zugewandten“ umschriebenen protestantischen Stände drohte somit vorläufig nicht.
Die Bedrohung durch den Expansionsdrang der osmanischen Sultane war im gesamten 16. Jahrhundert präsent, um im sog. langen Türkenkrieg der Jahre 1593 bis 1606 einen ersten Höhepunkt zu erreichen. Noch 1663/4, als türkische Großwesire nach einer Schwächephase des osmanischen Reiches in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihre Truppen erneut gegen das Heilige Römische Reich deutscher Nation ins Feld schickten, konnte man im Tagebuch des Ulmer Seldners (Kleinbauern) Hans Häberle lesen: „Die leit (Leute] sindt gefangen und nidergeseblet worden, indem er vüll viele stett eingenommen, zum theil in die aschen gelegt, das zue erbarmen ist. … Da ist ein grosser schreckh in der ganzten christenheit worden“. Erst 1683, nach der gescheiterten zweiten Belagerung von Wien, wendete sich das Blatt. Jetzt waren es christliche Mächte, allen voran die Habsburger, die das Geschehen auf dem Balkan zunehmend bestimmten.
Solange die osmanische Bedrohung währte, waren die deutschen Kaiser aus dem Hause Österreich zwingend auf den Rückhalt bei allen Reichsständen, auch den protestantischen, verwiesen. Dies nötigte sie zu mancherlei Konzessionen, gerade auch auf dem Felde der Reichsreligionspolitik, und schloss ein militärisch-aggressives Vorgehen des Reichsoberhauptes gegen die Protestanten aus. Die Reichstage vornehmlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren weithin Türkentage (Schulze). Hier wurde erbittert um die enormen Summen gerungen, die der Kaiser zu benötigte, um der Gefahr von außen begegnen zu können. Welch enorme Belastungen dabei auf Untertanen in den einzelnen Territorien und die Reichsstädte zukam, zeigen etwa die überlieferten Türkensteuerlisten des Herzogtums Württemberg.
Die Abwehr der Türkengefahr war ein finanzieller, militärischer und politischer Kraftakt. Um ihn erfolgreich bewältigen zu können, bedurfte es auch der Sinnstiftung wie der psychologischen Kriegsführung: Die Macht der Türken bzw. die Ohnmacht der Christen war zu erklären, zumal es sich bei dem Aggressor um Anhänger Mohammeds handelte, Irrgläubige und Feinde des Christentums; Obrigkeiten wie Untertanen mussten auf den aufgezwungenen Krieg eingeschworen werden, Leid, Not, Kriegsgefangenschaft waren zu ertragen. All dies war den Menschen verständlich zu machen. Einen zentralen Beitrag hierzu leistete die Predigt. Denn sie war unter den kommunikativen Bedingungen der frühen Neuzeit das Medium, das die meisten Menschen erreichte. Es ist daher nicht überraschend, wenn – insbesondere aus dem Luthertum – zahlreiche, meist deutschsprachige Türkenpredigten überliefert sind. Martin Luthers frühen und einflussreichen Publikationen aus dem Jahre 1530 (mit der Theorie vom zweiköpfigen, bikephalen Antichristen, Papst und Türke) folgten zahlreiche andere, auch aus der Feder bekannter wie unbekannter württembergischer Theologen. Zu verweisen wäre etwa auf Jakob Andreä, Johannes Brenz oder Heinrich Efferhen (I.).
Die Bedrohung von außen hatte für das Reich aber auch einen integrativ-befriedenden Effekt. Als nach dem langen Türkenkrieg die türkische Gefahr gebannt schien, fürchteten manche Zeitgenossen infolgedessen um Zusammenhalt und Friede im Reich. „Summum periculum“, die höchste Gefahr gelte nunmehr, so die Lageeinschätzung von Pfalz-Neuburg, der Reichsjustiz.
5.5: Rekonfessionalisierung der Reichspolitik und Dreißigjähriger Krieg
Rekonfessionalisierung der Reichspolitik
Ab 1580 ist eine zunehmende Desintegration des politischen System des Reiches im Zeichen konfessioneller Polarisierung offenkundig. Die sich mehrenden Auseinandersetzungen auf den Reichstagen über konfessionelle Streitfragen (z.B. über das Reformationsrecht der Reichsstädte) oder die Kriege um die Bistümer Köln (1582/83) und Straßburg (1584-1604) wären hierfür bezeichnende Beispiele. Auch die gewechselten Streitschriften beider konfessioneller Lager, an denen sich auch württembergische Theologen rege beteiligten, waren nicht eben dazu angetan, die Gemüter zu beruhigen.
Mediatisiertes Kirchengut: Juristischer Krieg und gesamtprotestantische Gefahrenlage
In den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit spielte das Herzogtum Württemberg, anders als in den theologischen Kontroversen, nur eine untergeordnete Rolle. Eine zwischen Reichsständen, Juristen und Theologen erbittert ausgetragene Kontroverse sollte allerdings eine Dynamik und eine Brisanz entwickeln, die für das Herzogtum existentiell bedrohlich wurde: die Frage, ob die nach 1552 (Passauer Vertrag) mediatisierten Kirchengüter zu restituieren seien, oder ob sie weiterhin im Besitz ihrer neuen Eigentümer, der lutherischen Fürsten, Städte und Kirchen verbleiben könnten. Über diese Frage wurden vor der höchsten Justiz des Reiches, dem Reichskammergericht, erbitterte Kontroversen ausgefochten und zahlreiche Prozesse geführt. Denn diese rechtliche Kontroverse war geeignet, den Besitzstand der neugläubigen Obrigkeiten und ihres Kirchenwesens massiv zu gefährden. Es drohte nichts weniger als ein juristischer Krieg gegen die protestantischen Reichsstände – und damit eine gesamtprotestantische Gefahrenlage. Rein rechtlich gesehen befanden sich die Protestanten im Nachteil: Denn sie mussten den Anspruch der Katholiken, strittige Fragen oder Lücken des Religionsfriedens seien mangels Alternative durch Rekurs auf das (die Katholiken begünstigende) gemeine Recht zu entscheiden, zurückweisen. Den von ihnen diesbezüglich vorgetragenen juristischen Argumente gebrach es (noch) an Legalität. Dies sollte sich erst mit dem Westfälischen Frieden (1648) ändern.
Konfessionelle Bündnisse
Die konfessionelle Aufladung von Reichspolitik und Reichsjustiz führte dazu, dass für den Zusammenhalt des reichischen Ordnungsgefüges zentrale Institutionen gelähmt wurden – zuletzt, 1613, der Reichstag. Erschwerend kam hinzu, dass die „Säulen des Reiches“, die Kurfürsten, sich zunehmend mehr an konfessionellen Loyalitäten denn an der konfessionsübergreifenden Sorge um das Wohl des Reiches orientierten und das Oberhaupt des Reiches, der Kaiser, zunehmend mehr als Haupt der katholischen Partei agierte denn als beiden Teilen wohlgewogenes Oberhaupt des Reiches, dem es gebühre, „einem thail wie dem andern nit allein geleich recht zu halten, sonder auch vätterlich gnad und lieb one alle partheyliche affection widerfaren zu lassen“ – so eine Aussage Kaiser Maximilians II. (25) Gleichzeitig wurden die vornehmlich politisch bedingten Differenzen unter den protestantischen Reichsständen offenkundig: Die wichtigsten von ihnen, die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen sowie der Pfalz verfolgten je eigene Ziele – Kursachsen in Anlehnung an den Kaiser („politice seint wir Bäpstisch“), Kurpfalz im dezidiertem Gegensatz zum Oberhaupt des Reiches.
Dabei verschoben sich innerhalb der protestantischen Reichstände die Machtverhältnisse zugunsten der Pfälzer: Auf die von der Reichsjustiz ausgehende Bedrohung verweisend, gelang es ihnen, ein militärisches Schutzbündnis, die Union, ins Leben zu rufen. Württemberg gehörte zu den Gründungsmitgliedern des 1608 geschlossenen Bündnisses, dem unter dem Direktorium des Pfälzer Kurfürsten schließlich acht protestantische Fürsten, die Grafen von Öttingen und 17 Reichsstädte angehören sollten, darunter Straßburg, Nürnberg und Ulm. Das Bündnis umfasste mithin nur einen kleinen Teil der protestantischen Reichsstände, vornehmlich im Südwesten des Alten Reiches – seine erste große Schwäche. Die zweite war der chronische Geldmangel. Als Gegenbündnis formierte sich nur wenig später, 1609, die katholische Liga. Gleichwohl sind im gesamten Dezennium vor dem Dreißigjährigen Krieg Bestrebungen zu verzeichnen, die drohende Konfrontation zu vermeiden. Unvermeidlich wurde der Krieg erst, als 1618 Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz die ihm angebotene böhmische Königswürde annahm.
Dreißigjähriger Krieg
Aus einem lokal begrenzten Ereignis, dem Aufstand maßgeblicher Gruppen des böhmischen Adels gegen ihren erwählten Landesherrn aus dem Hause Habsburg, entstand ein Krieg, dessen Ausmaß an Zerstörung und Not bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht mehr erreicht werden sollte und der sich bis zur Zeit des 2. Weltkriegs als die Urkatastrophe deutscher Geschichte tief ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben hat. In die protestantische Erinnerungskultur ist der 30jährige Krieg vor allem deswegen eingegangen, weil letztmalig in der deutschen Geschichte eine existentielle Bedrohung all des bisher Erreichten konkret vor Augen stand – was es dem 1631 in das Kriegsgeschehen eingreifenden schwedische König Gustav Adolf ermöglichte, sich zum „Retter des deutschen Protestantismus“ zu stilisieren. Bezeichnenderweise führte der 1832, am Jahrestag der Schlacht von Lützen im lutherischen Leipzig entstandene Gustav-Adolf Verein seinen Namen, betrachtete der dezidiert konfessionelle, vom liberal-protestantischen Bürgertum ins Leben gerufene Verein es doch als seine genuine Aufgabe, bedrängten evangelischen Gemeinden in der Diaspora zu Hilfe zu kommen.
Wie wir heute wissen, war es nicht vorrangig die kaiserlich-katholische Religionspolitik, die den schwedischen König zur kriegerischen Intervention bewogen, sondern die Ausdehnung der kaiserlichen Machtposition an die Nord- und Ostsee. Dem korreliert, dass der Dreißigjährige Krieg je länger, desto offenkundiger als Staatsbildungskrieg bzw. Staatenkrieg (und nicht als Religionskrieg) geführt wurde. Bezeichnenderweise konnte auch der lange Weg zum Frieden auch erst beschritten werden, nachdem für alle Beteiligten evident war, dass ein militärischer Sieg nicht zu erringen sei.
Der in Osnabrück und Münster 1647/48 abschließend ausgehandelte Friede war ein komplexes Vertragswerk: Er bestand aus einem spanisch-niederländischer Friedensvertrag, der den Niederlanden die Unabhängigkeit von Spanien einbrachte, und dem 1647/48 abschließend ausgehandelten Frieden von Münster und Osnabrück, einem Friedensvertrag zwischen dem Kaiser und Frankreich einerseits und dem Kaiser und Schweden andererseits, in den die Reichsstände als Verhandlungsbeteiligte einbezogen waren. Für die evangelischen Reichsstände brachte das eine Reihe substantieller Verbesserungen, insbesondere:
-
Die Bestätigung des Augsburger Religionsfriedens unter Einbeziehung der Reformierten und der Reichsstädte;
-
Die Einigung auf ein Normaljahr mit Blick auf Besitzstand ( 1624 statt 1552) und Kirchenwesen;
-
Eine Modifikation des Geistlichen Vorbehalts: die protestantischen Bistumsadministratoren waren nunmehr auf dem Reichstag zugelassen;
-
Die Festlegung von Verfahrensmodalitäten für den Fall eines Konfliktes zwischen den Konfessionen (itio in partes) und Garantie der Gleichheit zwischen den Konfessionen (Prinzip der Parität);
-
Eine Restitution der Reichsstände, die im Krieg ihrer Rechte verlustig gegangen oder vom Krieg verdrängt worden waren.
Das Herzogtum Württemberg im Dreißigjährigen Krieg
Das Herzogtum Württemberg wurde durch den Dreißigjährigen Krieg bereits in seiner ersten Phase tangiert, kurz nach der Niederlage des „Winterkönigs“ in der Schlacht am Weißen Berg von den Toren von Prag (1618). Bei Wimpfen (1622) erlitten Pfälzer Truppen eine zweite Niederlage, in deren Folge der württembergische Herzog Johann Friedrich seine Mitgliedschaft in der Union beendete und sich für neutral erklärte.
Die militärische Überlegenheit der Katholiken in der ersten Phase des Dreißigjährigen Krieges ermöglichte das sog. Restitutionsedikt, das Kaiser Ferdinand II. auf dem Höhepunkt seiner Macht am 6. März 1629 verkünden ließ und das die Rückgabe sämtlichen Kirchenbesitzes verfügte, der nach 1552 (Passauer Vertrag) von den protestantischen Obrigkeiten eingezogen worden war. In Württemberg betraf dies vor allem, aber keineswegs nur die vierzehn ehemaligen Mannsklöster und nunmehrigen Klosterschulen: Bis Dezember desselben Jahres waren sie alle an die katholische Kirche resp. die ehedem besitzenden Orden zurückzugeben. Mehr als ein Drittel der Besitzungen der württembergischen Herzöge waren damit verloren, von den finanziellen Einbußen ganz zu schweigen. Die Krise war, zumal inmitten des Krieges und einem übermächtig werdenden Kaiser existentiell bedrohlich – und dies macht verständlich, warum der neue Herzog Eberhard im April 1633 mit anderen evangelischen Ständen das Bündnis mit den damals noch siegreichen Schweden suchte (Vertrag von Heilbronn). Er führte damit sein Land in die definitive Katastrophe: Denn die Schlacht bei Nördlingen (Sept. 1634) endete mit einer katastrophalen Niederlage der Schweden sowie ihrer Verbündeten: Mehr als 4.000 württembergische Bauern, die als Landmiliz an der Schlacht teilgenommen hatte, fielen; dem Flüchtlingsstrom folgte eine plündernde Soldateska, und ihr Feuer, Hunger und Pest. Die Bevölkerung wurde dahingerafft: In Ulm starben 13.400 Einwohner, in Esslingen über 8.000, in Heilbronn 5.518, in Stuttgart 4.379. Der Herzog ging ins Straßburger Exil, sein Land wurde von kaiserlichen Truppen besetzt bzw. mehr oder minder willkürlich an Verwandte und Freunde des kaiserlichen Hauses verschenkt.
Der militärischen Niederlage folgte die mehr oder minder offensiv betriebene Rekatholisierung des Landes. Wie intensiv und mit welchen Strategien sie betrieben wurde, war höchst unterschiedlich. Das Spektrum reicht von dem dem Spitzel- und Polizeisystem, dessen sich der bayerische Kurfürst Maximilian in der Herrschaft Heidenheim bediente, über Zwangseinquartierungen (in den habsburgischen Besitzungen Göppingen und Blaubeuren) über die Versuche der Grafen von Schlick, durch Zwangsheiraten zwischen katholischen Männern und evangelischen Frauen einen allmählichen Konfessionswechsel herbeizuführen. Und unter den neuen Prälaten, die nun wieder in den württembergischen Klöstern amtierten, finden sich eher raue Gesellen wie Abt Alfons Kleinhans von Alpirsbach, der auf dem (von der Bevölkerung um Vermittlung gebetenen) Pfarrer Georg Stöffler von Freudenstadt mit dem Degen losging und den Fliehenden mit dem Pferd nachsetzte, begleitet von den wohlgesetzten Worten, er wolle ihn erschießen, auch wenn der Herzog selbst dabei wäre, über den Maulbronner Prälaten Christoph Schaller, der alle schwangeren Frauen sorgsam beobachten ließ, um dann die neu geborenen Kinder katholisch taufen zu lassen, bis zu dem Murrhardter Abt Emmerich Fünckler, der sich ausgesprochen moderat verhielt (und im Übrigen aufgrund seiner Sprache von den Bauern auch kaum verstanden wurde).
Ebenso unterschiedlich war das Verhalten der württembergischen Untertanen: Als „Wendehälse“ erwiesen sich vor allem die weltlichen Beamten. Anders die Bevölkerung: Selbst dort, wo der Druck besonders intensiv war, waren neben Übertritten zum Katholizismus Resistenz und opferbereite Glaubenstreue zu verzeichnen: Im Blaubeurer Amt wurden die Säuglinge etwa selbst im Winter mehrere Stunden zu einem evangelischen Geistlichen getragen, um sie taufen zu lassen. Von dem Laichinger Geistlichen ist bekannt, dass er mehr als 74 solch heimlicher Taufen und mehr als 30 Trauungen in Wohnungen von Evangelischen durchführte; und sein Sontheimer Amtsbruder vollzog solche Amtshandlungen auch im Freien, „unter der Linde“.
Mit der Restitution des Landes im Westfälischen Frieden war der Spuk vorbei. Die unerbetenen Gäste verließen das Land, das zu seinem lutherischen Glauben zurückkehrte.
Aktualisiert am: 13.03.2018
Bildnachweise
-

-
Martin Luther, Kupferstich nach einer Vorlage von Lukas Cranach
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 11.079
-

-
Die Reformatoren Luther, Huss, Zwingli, Melanchthon, und Calvin. Kupferstich, 19. Jahrhundert
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung 11.085
-

-
Luther auf dem Reichstag zu Worms, Kolorierter Holzschnitt, 1577
-

-
Luther auf dem Reichstag zu Worms, Kupferstich, 19. Jahrhundert
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung 92.607
-

-
Luther verbrennt die Bannandrohungsbulle, Holzschnitt, 1557
-

-
Das Religionsgespräch zu Marburg 1529, Kupferstich von August Noack, 1869
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung 93.442
-

-
Die evangelischen Stände geben am 25.7.1530 Kaiser Karl V. in Augsburg ihrer Konfession. Kupferstich, 17. Jahrhundert
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 93.497
-

-
Ulrich Zasius (latinisiert Huldrichus), zeitgenössischer Kupferstich
-

-
Die Reichsstadt Reutlingen (hier in einem Stich von 1643) gehörte zu den Erstunterzeichnern der Augsburger Konfession
-

-
Bannerträger "Freiheit". Holzschnitt 1522. Thomas Murner ironisierte emblemeatisch die Leitbegriffe der reformatorischen Bewegung "Evangelium", "Wahrheit" und "Freiheit eines Christenmenschen" in drei aufgeblasenen Bannerträgern.
Aus Thomas Murner: Von dem großen lutherischen Narren, Straßburg 1522
-

-
Bannerträger "Wahrheit". Holzschnitt 1522. Thomas Murner ironisierte emblemeatisch die Leitbegriffe der reformatorischen Bewegung "Evangelium", "Wahrheit" und "Freiheit eines Christenmenschen" in drei aufgeblasenen Bannerträgern.
Aus Thomas Murner: Von dem großen lutherischen Narren, Straßburg 1522
-

-
Bauern plündern das Kloster Weißenau. Zeichnung aus der zeitgenössischen Chronik des Abtes Jakob Murer, 1525
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 523, Bd. 58, Bl. 4.
-

-
Titel der Schrift von Johannes Brenz: Von Milterung der Fürsten gegen den auffruersche Baure, 1525
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Theol. qt. K. 65.
-

-
Stadtansicht Mömpelgart (Montbéliard), Kupferstich 1644
Topographia Alsatiae, von Matthäus Merian, Wolfgang Hoffmann, Martin Zeiller, 1644.
-

-

-

-
Herzog Ulrich von Württemberg in Rüstung mit Schwert samt Heerlager in der Schlacht bei Lauffen 1534
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 703 R128N4
-

-
Die Bilderserie "Herzog Ulrich der Verbannte" zeigt Szenen der Umstände der Vertreibung des württembergischen Fürsten aus seinem eigenen Land 1519 durch den Kaiser. 1534 kehrt er mit Hilfe seines Vetters, des hessischen Landgrafen Philipp I. zurück und fü
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 10.017
-

-
Die Bilderserie "Herzog Ulrich der Verbannte" zeigt Szenen der Umstände der Vertreibung des württembergischen Fürsten aus seinem eigenen Land 1519 durch den Kaiser. 1534 kehrt er mit Hilfe seines Vetters, des hessischen Landgrafen Philipp I. zurück und fü
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 91.177-21
-

-
Die Bilderserie "Herzog Ulrich der Verbannte" zeigt Szenen der Umstände der Vertreibung des württembergischen Fürsten aus seinem eigenen Land 1519 durch den Kaiser. 1534 kehrt er mit Hilfe seines Vetters, des hessischen Landgrafen Philipp I. zurück und fü
Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 10.016
-

-
Die Bilderserie "Herzog Ulrich der Verbannte" zeigt Szenen der Umstände der Vertreibung des württembergischen Fürsten aus seinem eigenen Land 1519 durch den Kaiser. 1534 kehrt er mit Hilfe seines Vetters, des hessischen Landgrafen Philipp I. zurück und fü
Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 10.018
-

-
Die Bilderserie "Herzog Ulrich der Verbannte" zeigt Szenen der Umstände der Vertreibung des württembergischen Fürsten aus seinem eigenen Land 1519 durch den Kaiser. 1534 kehrt er mit Hilfe seines Vetters, des hessischen Landgrafen Philipp I. zurück und fü
Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 10.019
-

-
Herzog Ulrich von Württemberg, Holzschnitt von Hans Brosamer um 1549
-

-
Der Reformator Erhardt Schnepf, Kupferstich 16. Jahrhundert
-

-
Der Reformator Ambrosius Blarer, Kupfersstich 16. Jahrhundert
-

-
Der Reformator Huldrych Zwingli
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung 97.101.01
-

-
Johannes Brenz (1499-1570), Ausschnitt aus dem Epitaph von Jonathan Sauter in der Stuttgarter Stiftskirche, 1584
-

-
Johannes Brenz (1499-1570), kolorierter Kupferstich, um 1568
-

-
Abendmahlskanne aus dem Ulmer Münster vom Ulmer Goldschmied und Zunftmeister Hans Miller, um 1530
Fotograf: Dieter Peters
-

-
Predigtdarstellung. Titelholzschnitt aus dem Brenzschen Katechismus, 1552
Württembergische Landesbibliothek, Theol. Qt. 1029
-

-
Der Katechismus von Johannes Brenz, 1528
-

-
Der Katechismus von 1837
Landeskirchliche Zentralbibliothek, Sign. 4231
-

-
Aus dem Inhaltsverzeichnis der Großen Kirchenordnung
Landeskirchliches Archiv Stuttgart
-

-
Klosteranlage Blaubeuren, kolorierte Zeichnung von Gabriel Bucelin, 1630
Württembergische Landesbibliothek
-

-
Schaubild: Die Leitung der württembergischen Kirche
Aus: Hermann Ehmer, Stiftsprobst in Stuttgart, in: Johannes Brenz 1499-1570, Hrsg. Hällisch-Fränkisches-Museum, 1999
-

-
Die württembergischen Seminare und Klosterschulen, kolorierter Kupferstich, 19. Jahrhundert
Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 91.109
-

- Einrichtung von Schulen
Aufforderung Luthers an die Ratsherren aller Orten, Schulen für Jungen und Mädchen einzurichten
Titelholzschnitt aus Luthers Schrift von 1524, gemeinfrei
-

-

-
Herzog Christoph von Württemberg in spanischer Tracht, Ölgemälde, nach 1568
Kunsthistorisches Museum Wien
-

-

-
Karte: Württemberg im Zeitalter der Reformation
Aus: Hermann Ehmer, Reformation in Schwaben, DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen, 2010. Mit freundlicher Genehmigung.
-

-
Karte: Südwestdeutschland im Zeitalter der Reformation
Aus: F. W. Putzgers historischer Schul-Atlas (1911)
-

Zitierweise
https://wkgo.de/cms/article/index/die-reformation-im-deutschen-sudwesten (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.